Die Gebärende, die Sorgende, die Kritische, die Streitende, die Liebevolle – ob anwesend oder abwesend, die Mutter verbindet uns alle. Aktuell wird sie in der Literatur häufig beschrieben und in Büchern wie „I’m Glad My Mom Died“ von Jennette McCurdy und „Mothercare“ von Lynne Tillman durchaus kritisiert, wobei die meisten Mutterschaften und Mütterlichkeiten Sarah Speck zufolge nach wie vor auf einem heteronormativen und patriarchalen Verständnis basieren. Was bedeutet also lesbische Mutterschaft und wie wird sie von queeren Künstlerinnen wie Catherine Opie, Cathy Cade oder A.L. Steiner dargestellt?
Queere Mutterschaft birgt besondere Hürden
Um dies zu beantworten, ist ein Blick auf die Politik unabdingbar. Schauen wir in Richtung USA, wo die hier genannten Künstlerinnen aufgewachsen sind und leben, ist die „traditionelle Ehe“ fest in der Politik verankert. So gab es in den 1970er-Jahren die ersten Gerichtsurteile zu Paaren, die die offizielle Anerkennung ihrer Ehen forderten, darunter schwule wie lesbische Paare. Diese wurden weitestgehend abgelehnt und die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau definiert. 1996 unterschrieb Bill Clinton den „Defense of Marriage Act“, doch dies war für viele konservative Politiker*innen nicht genug, um „die traditionelle Ehe zu schützen“. In der Folge argumentierte George W. Bush noch 2004, dass gleichgeschlechtliche Ehen „das Wohlbefinden der Kinder und die Stabilität der Gesellschaft“ untergraben würden. Erst seit 2015 sind gleichgeschlechtliche Ehen in den USA zum großen Teil staatenabhängig und nach Anhörungen möglich.

Jenette McCurdy, I’m Glad My Mom Died, Image via mavnewspaper.com
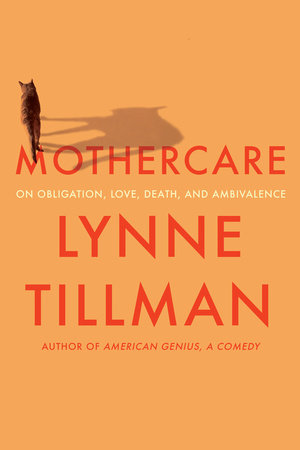
Lynne Tillman: Mothercare, Image via penguinrandomhouse.com
Wenig verwunderlich ist queere Mutterschaft demnach eine individuelle Erfahrung, die durch unsere heteronormativen und binären Gesellschafts- und Politikstrukturen mit besonderen Hürden, Traumata und Emotionen verbunden ist. Margaret F. Gibson argumentiert, dass politisches Desinteresse oder Ablehnung und fehlende Bildung in Bezug zur queeren Familiengründung, Erfahrungen für queere Eltern mit sich bringen, die sich nicht mit heteronormativen Familienstrukturen vergleichen lassen. Angefangen beim Kindeswunsch, der an mangelnden finanziellen Mitteln, fehlender Aufklärung oder aus biologischen Gründen scheitern und zu traumatischen Erfahrungen führen kann, bis hin zu den Ängsten bezüglich möglicher Diskriminierungen gegenüber den Eltern oder dem Kind.
Trauma, Schmerz und Hoffnung
Den Schmerz dieser Erfahrung visualisiert Catherine Opie in ihren Selbstporträts sowie in einer Reihe von Fotografien, die lesbische Haushalte in den 1990er-Jahren in den Blick nehmen. In der Reihe „Domestic“ zeigt sie intime Einblicke ihrer Community in ihren eigenen Häusern oder Wohnungen. Dabei wird fast jede Ethnizität, Geschlechtsidentität, Sexualität und Familienstruktur sichtbar. Mit Kindern oder ohne Kinder, Opie betont wiederholt, dass dies alles vollwertige Familien sind und macht diese nun sichtbar. So haben große Museen wie das Guggenheim (New York) und die Tate (London) einzelne Werke der „Domestic“-Reihe angekauft.
Doch der physische und psychische Schmerz der Familienbildung als queere Person wird vor allem in Opies Porträts sichtbar. Stilistisch an traditioneller Porträtmalerei von Hans Holbein angelehnt, sind Opie selbst wie auch andere Models dem Rücken der Kamera zugewandt. Die Porträts erzählen eine Geschichte: In „Self-Portrait/Cutting“ zeigt sie ihren Rücken als Leinwand, auf dem ihr ein Bild von einem Haus und zwei Strichfiguren eingeritzt wurde. Aus den Wunden tropft noch Blut, die Risse sind frisch. Die Figuren tragen Röcke, sie lächeln und sind umgeben von Wolken, einer großen Sonne und Vögeln. Ein Bild, das an eine idyllische Kinderzeichnung erinnern lässt, doch die brutalen Mittel, die hier offensichtlich eingesetzt wurden, vermitteln bildlich Schmerz und Unbehagen.

Catherine Opie, Domestic series (1995-98), Image via tumblr.com

Ein Jahr später geht Opie mit „Self-Portrait/ Pervert“ einige Schritte weiter. Nun zeigt sie sich oberkörperfrei von vorne. Ihr Gesicht ist unter einer Lederfetischmaske versteckt. Sie trägt ein Nippelpiercing in ihrer rechten Brustwarze, eine Reihe von Nadeln wurden symmetrisch und in regelmäßigen Abständen in ihre Arme eingeführt. Auf ihrem Brustbein hat sie sich den Schriftzug „Pervert“ eingeritzt und mit Ornamenten versehen, die an generische Tattoos aus den 1990er -Jahren erinnern. Alle Wunden sind durchdacht und systematisch, der dahinterliegende Prozess ist ein bewusster Akt, der Schmerzen auslöst. Das Wort „Pervert“ bezieht sich hierbei auf eine reiche Geschichte der Diskriminierung gegenüber queeren Menschen.
Zehn Jahre später zeigt sich Opie in „Self-Portrait/ Nursing“ erneut oberkörperfrei. Auch ihr Gesicht ist nun frei, die Narben der „Pervert“-Inschrift sind immer noch sichtbar, aber verheilt. Sie hält ihren nackten Sohn in einer fast ikonografischen Pose und lässt ihn an ihrer Brust saugen. Sie ist jetzt Mutter. Oder war sie es schon beim ersten Porträt? Opies Porträts reichen von dem Wunsch einer Familie, über Diskriminierung bis hin zur Mutterschaft und erzählen so die schmerzhafte individuelle Geschichte einer queeren Frau.

Catherine Opie: Self-Portrait/Nursing, 2004 © Catherine Opie, Image via guggenheim.org
Kein Raum für traditionelle Stereotypen
Auch Cathy Cade, ebenfalls US-amerikanische queere Fotografin, betrachtet ihre lesbische Community in privaten Momenten. Allerdings entstehen hierbei keine inszenierten Momente mit arrangierten Hintergründen und Posen, sondern viel mehr Schnappschüsse in schwarz-weiß. In „Laurie Hauer and Gusse II“ (1989) zeigt sie zwei Frauen vor einem Bett sitzend. Eine Frau spielt lachend mit ihrem Sohn auf ihrem Schoß. Die andere guckt auf den Sohn, auf ihrem Schoß liegt ein Säugling in Windeln. An seinem Nabel sieht man die Reste einer Nabelschnur. Eine sorgenfreie Szene einer Familie: Eine Schwarze Frau mit einem Schwarzen Sohn und eine weiße Frau mit einem weißen Säugling. Mit dem Wissen, dass es sich hierbei um ein lesbisches Paar handelt, lassen sich die Vorgänge dieser Familienbildung vermuten: Beide Frauen könnten jeweils einmal schwanger, einmal die Gebärende gewesen sein, sie könnten die Kinder adoptiert haben oder auf eine Leihmutter angewiesen gewesen sein. Doch wie auch immer man die dargestellte Familienstruktur analysieren will, sie geht gegen den heteronormativen Familienbegriff und hinterfragt bestehende Strukturen. Zugleich sind Bilder wie dieses, die publiziert und/oder ausgestellt werden, Solidaritätsbekundungen für andere queere Personen. Sie vermitteln, dass eine Familienbildung nicht unmöglich ist und bestätigen sie vielleicht sogar in ihrer Entscheidung, selbst eine Familie zu gründen.

Ein Raum der Solidarität
Dieses gemeinschaftliche Teilen von Erfahrungen, das bei Cade als Solidaritätsbekundung begriffen werden kann, steht auch im Zentrum von A.L. Steiners „Puppies & Babies“ (2012), für das die Künstlerin fotografische Momentaufnahmen queerer Frauen in eine Installation überführt. Hierbei tapezierte Steiner die Wände mit intimen Bildern, teils Schnappschüsse, teils posierte Aufnahme, in denen weiblich gelesene Frauen schwanger, beim Stillen oder nackt im Bett mit ihren Hunden und Kindern gezeigt werden. „Puppies“ ist das englische Wort für Welpen, aber auch ein umgangssprachliches Wort für Brüste. Mit diesem Wortspiel verleiht Steiner der provokativen Installation eine gewisse Leichtigkeit.
Was die Werke queerer Künstler*innen zur Mutterschaft damit verdeutlichen, ist, dass sie vor allem als Akt des Protests gegen die politischen und gesellschaftlichen Restriktionen und Vorbehalte einer gleichgeschlechtlichen Elternschaft zu verstehen sind. Zugleich fungieren sie als Solidaritätsbekundung mit all jenen, die durch ähnliche Erfahrungen geprägt sind – sei es derselbe oft unerfüllte Wunsch einer Familienbildung und die damit verbundenen Hindernisse, das hinterbliebene Trauma, oder auch Gefühle der Dankbarkeit gegenüber der eigenen Community. Sie vereint dabei eine entscheidende Botschaft: Egal ob mit oder ohne Kind, unabhängig von Familienkonstellation, Geschlecht und Identität, Wünschen und Hoffnungen, jede Familie ist eine vollwertige Familie.

A.L. Steiner: Puppies & Babies, 2012, Image via hellomynameissteiner.com