Ja, New York City ist immer besonders, schluckt einen auf mit dem Hunger eines höflichen Riesen, der fragt, bevor er zuschnappt, der auf dieser einsamen Insel lebt, wie die letzten Überlebenden eines Schiffsunglücks, die im Stile Robinson Crusoes bis heute an diesem mystischen Paradies bauen. Mein Flug endete in Newark, das Anstehen in der Einreiseschlange ermöglichte mir weitere zehn Kapitel in George Perecs „Das Leben. Gebrauchsanweisung“.
Nach jedem U-Turn in der Schlange blieb ein anderes Gesicht, das ich schon vorher erblickt hatte, in meiner Wahrnehmung haften. Das Anstehen wurde beschleunigt, indem sie die lange Schlange in kleine Portionen und diese auf die drei geöffneten von 200 Schaltern verteilten.
Draußen war es bitter kalt. Der Bus so hell erleuchtet wie ein Fußballstadion. Die Dunkelheit war kaum zu erkennen. Die Straße war voll mit Autos. Immer wieder bremste der Bus abrupt und fuhr wieder an, wie nach einem Boxenstopp. Nach einer langen Tunnelfahrt erblickten wir endlich Manhatten, das mit seinen Tausenden leuchtenden und blinkenden Fassaden nicht zu übersehen war. Der Verkehr mühte sich ruhig und gelassen ab. Die Routine der täglichen Rush-Hour war erschreckend, mein Körper wurde unruhig und stieg bei der ersten Gelegenheit aus. Ab jetzt und für die nächsten Tage unternahm ich keinen Schritt mehr ohne die digitale Assistenz und erfreute mich in der Choreographie einer Kompassnadel.

Vom Hotel aus ging es zum New Museum, wo ich meine Kollegin Inka Drögemüller und einen Kollegen aus dem Metropolitan, der einst dem Team unserer Jeff Koons-Ausstellung angehörte, traf und wo es um 20 Uhr so voll war wie bei einer Schirn at Night. Es lag auch daran, dass es einer der letzten Tage der ersten institutionellen Soloausstellung von Sarah Lucas in den USA war. Zusammengefasst könnte man bei der Ausstellung an einen Werbespot für Eier und Würste denken. Zuletzt habe ich mich gefragt, ob der extrem enge Parcours und die Sorge, unabsichtlich die Kunst zu berühren, in manchen Räumen dieser Ausstellung beabsichtigt war.
Die nach einer darmförmigen Verarbeitung der Skulpturen von Louise Bourgeois und Jeff Koons anmutenden NUDS stehen rüpelhaft herum, so als ob sie nur darauf warten würden, angefasst zu werden. Am Ende habe ich zwar einmal alles gesehen, auch das immer noch extrem ausdrucksvolle Selbstporträt mit Spiegeleiern auf Brüsten, dadurch aber auch so manche Wiederholung.

Am nächsten Tag erwartet uns dafür eine leere Andy Warhol-Ausstellung im Whitney Museum, die in den frühen Morgenstunden nur für angemeldete VIPs zugänglich ist. Auch wenn mir die meisten Arbeiten dieser lange geplanten Retrospektive bekannt waren, gab es doch auch Überraschungen – bei einem Werkumfang, der die Länge mancher Stadtmauern misst, auch kein Wunder. Wahrlich entzückend eine Performance von Warhol, bei der er den Teppichboden einer Galerie saugte, um den zuvor neu erworbenen Beutel nach getaner Arbeit zu signieren und auszustellen.
In den Galerien in Chelsea laufe ich ein gewohnt hochwertiges Programm ab, was leider auch wenig Überraschung bietet. Catherine Opie hat erstmals auch einen Film gemacht, der neben Fotografien und Collagen mit dem Titel „The Modernist“ ein sehr schönes Gesamtkunstwerk ergibt, das mich tatsächlich berührt, aber eher zum Einschlafen, anstatt zum Aufstehen.

Michael Kostiuk, Andy Warhol vacuuming the carpet for an installation piece, c. 1972; Founding Collection © 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York, Image via whitney.org
Der Film, der aus einzelnen Fotos im Stil von Chris Markers „La Jetée“ komponiert ist, folgt einer Person durch eine leere Villa in Los Angeles, die die Absicht hat, das Haus niederzubrennen. Innovativ und ansprechend und kraftvoll und so weiter ist die Arbeit der 1985 in Malaysia geborenen Mandy El-Sayegh.
Kunst, die berührt - aber eher zum Einschlafen
Die Ausstellung „Mutations in blue, white and red“ zeigt eine große Spannbreite, von Gemälden auf Leinwand und auf Zeitungspapier bis hin zu Materialassemblagen in Tischvitrinen, die detailreich sind und durch ihre formale Lösung im Kleinen wie im Großen beeindrucken. In der Ausstellung „God made my face: A collective portrait of James Baldwin“ kann man nicht nur den Schriftsteller James Baldwin kennenlernen und die aktuellen Fragen nach Macht und den Möglichkeiten der Öffentlichkeit, sondern auch das transformative Potential von Galerien, selbst eine öffentliche Rolle anzunehmen und den ökonomischen Primat von, wie es auch heißt, kommerziellen Galerien mit einem Bildungsauftrag zu verbinden.

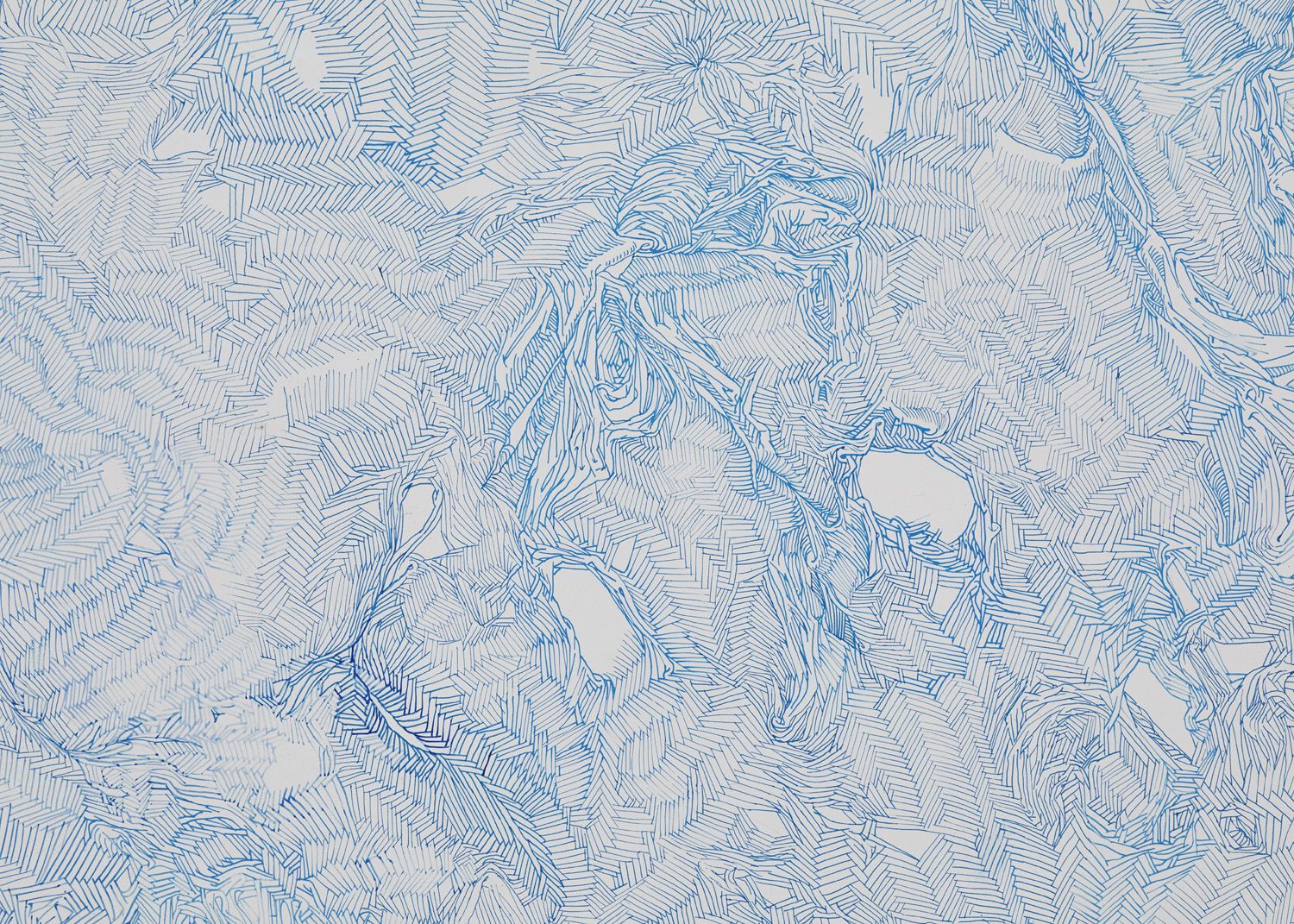
Mandy El-Sayegh, Window 4 (detail), 2018, Image via www.lehmannmaupin.com
Am Abend dann ein herzliches Wiedersehen mit Nina und Max Hollein. Im schmalen Stadthaus gleich um die Ecke des Metropolitan Museums hängen die Wände voll mit Kunst. Sie erzählen von den zahlreichen Willkommensempfängen, die für sie gleich in den ersten Wochen nach ihrem Weggang aus San Francisco ausgerichtet worden sind, von Norman Foster über Aby Rosen bis zu Ronald S. Lauder, berichten von der Met Gala und dem Sammler, der sich für ein paar Millionen Dollar Zutritt verschaffen wollte, die letzte Hürde jedoch, Anna Wintour, nicht schaffte. Erneut gleich um die Ecke, ganz nach dem geflügelten Wort unseres ehemaligen Chefs: „rasch abwickeln“, essen wir in einem Steakhouse (Zitat Hollein: „…die haben auch Fisch“) das, wofür der Laden offenbar bekannt ist. Und als ich ebenfalls ein Steak bestelle, kommt stante pede der Kommentar: „Wie, Sie essen wieder Fleisch?“

Marlene Dumas, James Baldwin (2014) from the series Great Men, 2014 – present, Courtesy David Zwirner, Image via dazedgroup.netdna-ssl.com
Nächster Tag
In Chinatown herrscht „Häuptling Klapperndes Geschirr“. Eine leerstehende Bürofläche mit einem guten Dutzend verglaster Räume standen dem in New York lebenden Künstler Kai Althoff zur Verfügung. Schwankende Böden aus bemalter Tapete über Dämmmatten, die weiter über die Wände und die Decke reichen – mehr, so scheint es, muss in Sachen immersive Kunst nicht unbedingt getan werden. Althoffs Aneignung einer chinesisch beeinflussten Malerei wirkt leicht und selbstverständlich. Die ganze Ausstellung erscheint unaufgeregt, so „Lieber Maler, male mir“-mäßig: schön, bescheiden und im künstlerischen wie auch gesellschaftlichen Sinne ambivalent.
Das Museo del Barrio empfängt einen in der Eingangshalle mit fröhlicher Samba-Musik und in den Galerieräumen mit einer stilistisch vielfältigen und eindrucksvollen Präsentation von Arbeiten der 1941 in Argentinien geborenen Liliana Porter. Trotz der retrospektiven Anlage öffnet die Ausstellung leider nur ein kleines Fenster in das sehenswerte, ironische Werk der Künstlerin. Neben einem ihrer Schattenbilder, mit denen sie in den späten 1960er Jahren Bekanntheit erlangte, bleibt meine Aufmerksamkeit vor allem an den feministisch-konzeptuellen Foto-Wand-Installationen hängen, bei denen solch einfache Formen wie Dreieck und Kreis aus fotografierten Händen hervorgehen.


Nach einem Atelierbesuch eines Schweizer Künstlers in Harlem schließt die Neueröffnung des opulenten Raumschiffs Gavin Brown‘s Enterprise an, wo sich an diesem Nachmittag die hippe Kunstszene Manhattans einfindet, um der Präsentation des Opus Magnum von Filmemacher Michel Auder, „Fictional Art Film“ von 2019, beizuwohnen. Bei dem Film handelt es sich um ein Portrait der New Yorker Kunstwelt.
Zu sehen sind Künstler, mit denen Auder herumhing
Künstler und Schriftsteller, mit denen Auder herumhing, sind darin zu sehen, beispielsweise Willem de Kooning, Harry Smith, Niki de Saint Phalle, Martin Kippenberger, Gregory Corso, Alain Robbe-Grillet, Larry Rivers, Brigid Berlin, Bill T. Jones, Larry Bell, Taylor Mead, Jean Tinguely, Marcia Resnick, Robert Mapplethorpe, Andy Warhol, Michael Buthe, John Ashbery, Cindy Sherman, Brice Marden, Viva, Jonas Mekas, Louis Waldon, Shirley Clarke, William S. Burroughs, Malcolm Morley, Charles James, John Chamberlain, Hannah Wilke, Bob Rauschenberg, Alice Neel, David Hammons und noch einige mehr.

Michel Auder, Fictional Art Film (Filmstill), 2019, courtesy the artist and Gavin Brown’s Enterprise, Image via www.paris-la.com
Gleich um die Ecke in der Columbia University zeigt die Wallach Art Gallery eine exquisite und aufschlussreiche Ausstellung über den Einfluss schwarzer Menschen, insbesondere Frauen, als Figuren der Malerei und Skulptur auf die moderne Kunst. Den Ausgang in der „Posing Modernity: The Black Model from Manet and Matisse to Today“ betitelten Ausstellung nimmt das Gemälde „Olympia“ von Edouard Manet und dem von Manet oft eingesetzten, schwarzen Modell Laure. Die Ausstellung zieht einen weiten Bogen bis in die Gegenwart zu einer rollenvertauschten Rekonstruktion des genannten Manet-Gemäldes von Aimé Mpane oder einem leicht an Andy Warhol erinnernden Portrait der großen Angela Davis von Mickalene Thomas.
Am letzten der fünf Tage noch einmal ein Atelierbesuch in Harlem, wo offenbar noch ganze Häuser für weniger Geld zu haben sind, dann beglückt und bestückt mit High Times T-Shirts diesmal mit dem Zug zurück nach Newark, noch vor Sonnenuntergang, sodass einem aus der Distanz das ferne und hohe Manhattan in der Tat wie eine Insel erscheint.

