Critical Land.
Sprache schafft Veränderung
05.06.2021
38 min Lesezeit
In der letzten Folge der englischen Podcast-Reihe mit Indigenen Perspektiven auf Kunst, Natur und Dekolonisierung spricht Cree-Schriftstellerin Jessica Johns über Träume, Trauerreden und Indigene Literatur.
Transkript
Sylvia Cunningham: Willkommen bei „Critical Land“. Ich bin eure Moderatorin, Sylvia Cunningham. Dies ist die vierte und letzte Folge des englischsprachigen Podcasts der SCHIRN, der parallel zur Ausstellung „Magnetic North: Mythos Canada in der Malerei 1910-1940“. Dieser Podcast war eine Gelegenheit, einige der Themen aus „Magnetic North“ aufzugreifen und über das hinauszugehen, was an den Wänden der Galerie zu sehen ist. Im Laufe dieser Serie haben wir mit Indigenen Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen über die Group of Seven, die Dekolonialisierung von Kunst, die Bedeutung von Land und Landschaft gesprochen sowie was in Gesprächen über den Klimawandel fehlt. In der heutigen Folge gehen wir einen Schritt weg von der Kunst in die literarische Welt, wo wir eine Generation von Autor*innen finden, die sich mit vielen dieser Themen auseinandersetzt. In diesem letzten Kapitel von „Critical Land“ hören Sie von der Cree-Schriftstellerin Jessica Johns, einem Mitglied der Sucker Creek First Nation im Treaty 8-Territorium im Norden von Alberta, Kanada. Sie lebt jetzt in Vancouver, wo sie die Chefredakteurin des feministischen Literaturkollektivs Room Magazine ist und die Lesereihe Indigenous Brilliance mitorganisiert. Außerdem arbeitet sie an ihrem Debütroman „Bad Cree“. Hier ist mein Gespräch mit Jessica Johns, ohne Umschweife.
Sylvia Cunningham: Bevor wir zu deinen Texten kommen, und weil dies unsere letzte Folge ist, möchte ich zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, nämlich der Ausstellung in der SCHIRN, wo die Werke der Group of Seven zum ersten Mal in Deutschland gezeigt werden. Ich bin neugierig: Als wir dich um das Interview baten und die Group of Seven erwähnten, hattest du da irgendeine Verbindung zu deren Kunst?
Jessica Johns: Nein…
Sylvia Cunningham: Überhaupt nicht?
Jessica Johns: Ganz und gar nicht.
Sylvia Cunningham: War die Gruppe jemals Teil des Lehrplans oder etwas, das du an den Wänden gesehen hast oder…?
Jessica Johns: Wenn ich sage überhaupt nicht, meine ich keine persönliche Erfahrung… Ich bin mehr in der literarischen Welt und nicht so sehr in der Kunstwelt, aber sie überschneiden sich an einigen Punkten, und so habe ich durch Künstler*innenfreund*innen schon davon gehört, aber ansonsten keine persönliche Verbindung.
Sylvia Cunningham: In unserer ersten Folge sprachen wir mit einer Lakota-schottischen Kunstprofessorin namens Carmen Robertson. Sie erzählte, dass sie, als sie in einer Kleinstadt aufwuchs, nicht viel mit Kunst in Berührung kam, aber trotzdem wusste wer die Group of Seven war. Also habe ich mich gefragt, ob du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast. Aber wie ich bereits erwähnt habe, haben wir diesen Podcast als Chance genutzt, um über die Ausstellung hinauszugehen. In unserer letzten Folge des Podcasts habe ich mit Jocelyn Joe-Strack gesprochen, die ein Mitglied der Champagne und Aishihik First Nation ist. Sie bezeichnet sich selbst als „Scientist in Recovery“, was zum Teil auf ihre Erfahrungen mit der akademischen Welt zurückzuführen ist. Als sie zum Beispiel ihren Doktortitel anstrebte, wurde ihr gesagt, sie solle ihre Forschungen über Landansprüche mit Literatur von nicht-Indigenen Akademiker*innen aus dem Süden untermauern, die ihrer Meinung nach sehr unterentwickelt ist. Sie entschied sich schließlich, das Doktorandenprogramm zu verlassen, nachdem sie in dieser Sache in eine Sackgasse geraten war. Ich habe mich gefragt, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast.
Jessica Johns: Ja, das ist leider ziemlich häufig. Es ist ziemlich üblich, dass es in Institutionen historisch gesehen eine bestimmte anthropologische Sichtweise auf Indigene Völker aus der Sicht von Weißen oder Nicht-Indigenen gibt, was wirklich schwierig und problematisch ist, wenn man als Indigene Autorin oder Künstlerin gelebte Erfahrungen hat und nicht als Außenstehende hineinschaut. Ich habe also ähnliche Erfahrungen in der akademischen Welt gemacht. Ich habe meinen MFA an der UBC für kreatives Schreiben gemacht. Davor habe ich meinen Bachelor-Abschluss in Literatur gemacht. Und in beiden Fällen gab es Momente, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich aufgefordert wurde, mich außerhalb meiner selbst zu betrachten. Das ist eine sehr dissoziative Art, seine eigene Identität zu verstehen. Besonders deutlich wurde das im MFA-Programm, wo wir aufgefordert wurden, das Geschichtenerzählen und das Schreiben mit sehr eurozentrischen Traditionen zu üben und auf der Grundlage eurozentrischer Erzähltraditionen. Und das ist wirklich schwierig, wenn die eigenen Erzähltraditionen oder das, was man für gültiges Wissen hält, als eine Art zu kommunizieren und Geschichten zu erzählen, nicht bestätigt wird und wenn man aufgefordert wird, weiße Akademiker*innen oder weiße Autor*innen zu zitieren und zu lesen, die nicht den gleichen Kontext und das gleiche Wissen haben wie man selbst – und zwar um die eigenen gelebten Erfahrungen herum.
Sylvia Cunningham: Was war für dich die Art und Weise, wie du durch diese Erfahrung navigiert hast? Hattest du das Gefühl, dass du an einigen Stellen Arbeiten geschrieben und geschaffen hast, auf die du dann nicht unbedingt stolz warst oder die nicht widerspiegelten, wer du bist?
Jessica Johns: In gewisser Weise hatte ich das Gefühl, dass es meiner eigenen kreativen Arbeit geschadet hat. Vor allem am Anfang, als ich eine neue Autorin und MFA-Studentin war – ich bin gerade am Anfang, ich lerne gerade und ich nehme alles, was mir gesagt wird, sehr ernst, wenn also eine einflussreiche Person, ein*e Professor*in, ein*e etablierte*r Autor*in mir sagt, dass, wie auch immer ich etwas mache, es falsch ist, dass es die Leute nicht interessieren wird, dass es sich nicht verkaufen wird … das ist wirklich schädlich. Ich schaue auf einige Arbeiten zurück, die ich geschrieben habe, die einfach nicht nach mir klingen. Dann machst du Workshops und bekommst Feedback von deiner Kohorte, deinen Kolleg*innen. Wenn das überwiegend nicht-Indigene Kolleg*innen und überwiegend weiße Kolleg*innen sind, bekommt man dieses Feedback noch einmal verstärkt. Das hat mein Schreiben in vielerlei Hinsicht beeinflusst, und es fühlte sich nicht gut an, aber dann, als ich mich ein bisschen mehr in der Welt des Schreibens verwurzelt hatte, gelernt habe wie sie funktioniert und die Probleme damit. Ich analysierte die Art und Weise, wie die weiße Vorherrschaft und der Kolonialismus Indigene Geschichtenerzähler*innen und Schriftsteller*innen in Kanada für eine wirklich lange Zeit gestört und verletzt haben. Meine vom Writers‘ Trust preisgekrönte Kurzgeschichte „Bad Cree“, aus der jetzt ein Buch gemacht wird, entstand sozusagen als Gegenreaktion auf den Rat eines weißen Professors, etwas nicht zu tun, und zwar nicht über Träume zu schreiben, was in der Cree-Kultur ein sehr wichtiges Erzählmittel ist. Es ist ein bedeutendes und essentielles Verständnis von Wissen und den Möglichkeiten, mit Menschen zu kommunizieren. So wurde mir von jemandem in einer Gruppe von Leuten gesagt: „Schreib niemals über deine Träume, die Leute werden sich nicht dafür interessieren, du wirst dein Publikum verlieren“. Das machte mich richtig wütend. Also schrieb ich dieses Stück als eine Art „Ich zeig’s dir!“.
Sylvia Cunningham: Und das hast du.
Jessica Johns: Ja, das habe ich! Aber davon abgesehen sollte das nicht passieren… diese Arbeit, diese Art von „Resilienz“-Narrativ sollte Indigenen Menschen nicht aufgezwungen werden, um sie zu überwinden und zurückzuschlagen um mit einer preisgekrönten Arbeit zu antworten. Deshalb habe ich gewonnen, das hätte gar nicht erst passieren dürfen, stattdessen wären jahrelange Mentor*innenschaft und Unterstützung in der Art und Weise meines Schreibens von Anfang an viel vorteilhafter gewesen als das, was am Ende in meiner akademischen Karriere passiert ist.
Sylvia Cunningham: „Bad Cree“, die Geschichte, die du erwähnst, wurde zunächst als Kurzgeschichte im Grain Magazine veröffentlicht und du wandelst sie jetzt in einen vollständigen Roman um. Was ist das für ein Prozess, die Geschichte auszufüllen oder auszudehnen? Ich weiß nicht einmal, wo man anfängt – ist es so, dass der Roman irgendwie dort weitergeht, wo die Kurzgeschichte aufgehört hat, oder vergrößerst oder erweiterst du tatsächlich Abschnitte, die du zuvor gekürzt hattest?
Jessica Johns: Das ist eine sehr gute Frage, es gab so viele Iterationen und Änderungen an diesem Stück, um es in einen Roman zu verwandeln, und es ist immer noch in einem sehr frühen Entwurfsstadium, also wird es sich noch mehr verändern. Aber meine ursprüngliche Entscheidung, es zu erweitern, kam daher, dass ich noch nicht fertig damit war. Ich dachte weiter über die Geschichte nach. Ich dachte immer wieder über andere Dinge nach, die ich damit machen wollte. Die Figur blieb bei mir. Ich dachte immer wieder über andere Dinge nach, die sie tun würde, und über andere Traumerlebnisse, die sie haben würde. Also begann ich, diese Ideen zu erweitern und dann war es eine Art von beidem. Besonders als ich es meinem Agenten zeigte und als wir den Redaktionsprozess begannen, wurde es zu einem Prozess des Aufblähens von Bereichen, also war es wie eine Erweiterung der Geschichte, und dann wurde an bestimmten Teilen der Geschichte gefeilt und diese vergrößert und aufgebläht und tiefer in die Entwicklung der Charaktere, in die Szenen hineingegraben. Nachdem ich all das getan hatte, hatte ich plötzlich 200 Seiten…
Sylvia Cunningham: Oh wow…
Jessica Johns: Ich weiß. Und ich habe mich gefragt, wie das überhaupt passiert ist, und noch einmal, es verändert sich immer noch, und es wandelt sich immer noch, aber es fühlt sich auf diese Weise irgendwie organisch an.
Sylvia Cunningham: Siehst du es also als ein begleitendes Stück oder fast als ein neues Werk, das ein Eigenleben entwickelt? Denn bei der Kurzgeschichte hat man einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, oder zumindest weiß man, wo man sie abgeschlossen hat, aber vielleicht wird der Ort, an dem man sie abgeschlossen hat, im Roman nicht mehr derselbe sein. Siehst du die beiden als zwei getrennte Einheiten an?
Jessica Johns: Es gibt so viel von dem Originalstück in dem Roman, aber es ist trotzdem komplett anders. Also sehe ich es definitiv als eine eigene Sache an. Aber man kann zu 100 Prozent sehen, wie dies der Samen war und dies der Baum ist.
Sylvia Cunningham: Es gibt einen kurzen Auszug, den ich gerne aus „Bad Cree“ vorlesen würde… Du schreibst: [Eigene Übersetzung, Anm. d. Red.] „Es ist zwei Jahre her, dass ich High Prairie, meine Heimat, verlassen habe, die Stadt, in der ich geboren und mit meinen zwei Geschwistern aufgewachsen bin. Als ich umzog, kam meine Mutter hinten aus dem Haus und fand mich, wie ich Erde in eine Flasche füllte. Sie schüttelte nur den Kopf und sagte, dass es mein Körper ist, der die Erde nach Hause trägt, nicht das Land. Es ist der schlimmste Albtraum einer Cree-Mutter, dass ihre Familie auseinandergerissen wird. Und jetzt bin ich hier, tausend Meilen entfernt in Vancouver. Eine Flasche Prärieerde auf meinem Nachttisch.“ Dieser Satz: „Es war mein Körper, der mich nach Hause trug, nicht das Land.“ Kannst du dich auch persönlich mit diesem Gefühl identifizieren?
Jessica Johns: Ja, ich habe diese Zeile tatsächlich geändert, und ich habe viel darüber nachgedacht, weil ich zu der Zeit viele Arbeiten von Quill Christie-Peters gelesen habe, einer bildenden Künstlerin der Anishinaabe, und sie schreibt viel darüber, wie die Rückverbindung zur Heimat und die Rückverbindung zum Heimatland ziemlich schwierig sein kann, weil viele Indigene Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Eine der Arten, wie sie darüber spricht, wieder nach Hause zu kommen und sich zu Hause zu fühlen, ist, dass die Heimat mit uns in unserem Körper lebt. Sie ist in unserem Blut, sie ist in unserem Knochenmark. Ich habe viel darüber nachgedacht, und das hat mich beim Schreiben sehr angesprochen. Ich habe diese Zeile jetzt geändert, so dass sie lautet: „Es ist unser Körper, der die Heimat trägt, genauso wie das Land.“ Anstelle von „nicht das Land“. Denn egal, wo du bist, ob es deine Heimat ist oder nicht, Land ist so sehr… ist so eine Erweiterung unseres Körpers und von uns selbst, und egal, ob das so ist, wenn du in einer Stadt bist… da ist vielleicht Beton unter deinen Füßen, aber da ist Land, du bist auf einem Territorium, das so ist, dass ich hier auf einem unbestrittenen Territorium bin, das nicht mein Territorium ist, das ich entwickeln und tief über meine Beziehung zu diesem Ort nachdenken muss. Ich denke also, dass diese beiden Dinge wirklich wichtig sind, und nicht nur das eine oder das andere, wie es die erste Iteration der Zeile suggerierte.
Sylvia Cunningham: Ich möchte das aufgreifen, was du gerade mit dem Leben auf nicht anerkanntem Gebiet gesagt haben. Die Protagonistin sagt, dass sie nach „Vancouver“ zieht. Aber außerhalb der Geschichte gibst du an, dass du „auf dem traditionellen Territorium der Musqueam-, Squamish- und Tsleil-Waututh-Völker“ lebst und arbeitest. Kannst du für diejenigen, die mit dieser Unterscheidung nicht vertraut sind, die Bedeutung dieser Anerkennung erklären und vielleicht auch, warum du dich in der Geschichte dafür entschieden hast den Ort als Vancouver zu benennen?
Jessica Johns: Ich glaube, ich habe Vancouver geschrieben, weil das ein Ort ist, mit dem die Leute vertraut sind, wenn sie eine Geschichte lesen und wissen, wo das ist. Mir gefällt jedoch die Idee, das zu zerstören, was die Leute über einen Ort zu wissen glauben, wenn es sich in Wahrheit um nicht anerkannte Gebiete handelt. Vancouver ist die kolonisierte Stadt des Landes, das einst den Musqueam, Squamish und Tsleil-Waututh-Völkern gehörte – und immer noch gehört. Und „unceded“ zu sein bedeutet, dass sie sich nie auf einen Vertrag mit den Europäer*innen und Siedler*innen geeinigt hatten, es gab also buchstäblich keine Diskussionen, sie haben einfach das Land übernommen und besetzt, das ihnen nicht gehörte. Das ist also der Unterschied.
Sylvia Cunningham: Ich möchte dich darüber befragen, wie du dich der Sprache näherst… weil ich auf ein Interview gestoßen bin, das du 2017 in PRISM international gemacht hast, wo du früher die Lyrikredakteurin warst. Damals hast du den preisgekrönten Schriftsteller aus der Driftpile Cree Nation, Billy-Ray Belcourt, interviewt. Sein Debüt-Gedichtband „The Wound is a World“ war gerade herausgekommen. Und eines der Themen, die ihr besprochen habt, ist die Sprache beim Schreiben. Du sprachst mit deiner Mitherausgeberin darüber, dass, wenn sie Cree-Wörter verwendet, sie diese in der phonetischen Schreibweise einklammert, Billy diese Wörter verwendet und neu definiert, wie er es tut. Damals sagtest du, dass du Cree-Wörter übersetzt, wenn du sie verwendest. Haben sich deine Entscheidungen bezüglich der Sprache oder deine Philosophie darüber in den letzten drei, vier Jahren geändert?
Jessica Johns: Ja, deutlich…danke, dass du mich daran erinnerst! Ich habe gerne mit Billy und Selina gesprochen. Und ich liebe es, mit Menschen über Sprache zu sprechen, besonders mit Indigenen Menschen, die eine Sprache lernen oder vielleicht nicht lernen, und einfach über ihre Beziehung zur Sprache zu sprechen. Auch das ist etwas, das sehr belastend ist und sich ziemlich verändert hat. Denn ich mache das nicht mehr, ich übersetze keine Cree-Wörter mehr in meinen Texten und ein Grund dafür ist… es gibt eine Schriftstellerin namens Leanne Simpson, eine Anishinaabe-Schriftstellerin und Akademikerin, die ich sehr bewundere und folge, also lehne ich mich hier ein wenig an ihre Weisheit an, denn sie hat viel darüber gesprochen. In ihrer Arbeit hat sie früher Sachen ins Englische übersetzt aber in neueren Werken tut sie das nicht mehr und ihre Begründung dafür ist, dass im Zeitalter der Information, Leute mit einem Knopfdruck nachschlagen können, was dieses Wort bedeutet, wenn sie das wollen. Es ist eine Art von Arbeit, die man als Leser*in tun kann, und für eine Cree-Person, die das liest, wird sie es lesen und etwas ganz anderes aus dieser Lektüre mitnehmen als eine nicht-Cree- oder eine nicht-Cree-sprechende Person es tun würde. Ich mag das, ich mag, dass es da mehrere Ebenen gibt und auch, dass wir das die ganze Zeit machen. Wenn wir auf ein englisches Wort stoßen, das wir nicht kennen, setzen wir es entweder in den Kontext oder wir schlagen es nach, weil wir sagen: „Ich habe keine Ahnung, was das Wort bedeutet.“ Es ist einfach so, warum normalisieren wir das für Englisch und zitieren „nicht fremd“… was so seltsam ist, dass Cree in Kanada als „fremd“ angesehen wird, also ist das eine Praxis, die ich in letzter Zeit angefangen habe, nämlich die Sprache nicht zu übersetzen, wenn ich sie benutze und sie einfach für sich existieren zu lassen.
Sylvia Cunningham: Einer der Aspekte, die ich wirklich an deinem Schreiben liebe, ist, wie viel Humor du hast. Selbst wenn du über dunklere Themen sprichst, wie in deiner Geschichte „Good Bones“, die im März 2018 in Cosmonauts Avenue veröffentlicht wurde. Sie fasst das sogar mit der ersten Zeile zusammen, die ich vorlesen werde: [Eigene Übersetzung, Anm. d. Red.] „Als meine Schwester ihre Trauerrede findet, ist sie wirklich nicht beeindruckt. Dabei hätte sie sich eigentlich freuen müssen, finde ich, wenn ich es geschafft hätte, so viele nette Dinge über sie zu sagen.“ Ohne zu viel zu verraten, erfahren wir, dass dieser Charakter viel Zeit damit verbringt, sich vorzustellen, auf welche Weise Menschen sterben werden – nicht auf eine morbide Art, oder zumindest so, wie ich es verstanden habe, für mich war es eher eine Art, auf alles vorbereitet zu sein. Ich habe mich gefragt, ob du glaubst, dass das so etwas wie ein Abwehrmechanismus ist, als ob die Trauer nicht so intensiv sein wird, wenn man weiß, dass man buchstäblich auf alle möglichen Umstände vorbereitet ist?
Jessica Johns: Das ist eine gute Frage…ich weiß nicht, was das ist. Eine meiner Freundinnen – und wirklich brillante Schriftstellerin, sie heißt Samantha Nock und ist eine Métis-Schriftstellerin – hat eine Zeile in einem Gedicht, es ist so etwas wie… „Kokum sagt mir, ich soll meine traurigste Geschichte erzählen und sie mit meinem größten Witz fortsetzen.“ Das findet man oft oder ich habe es oft bei Indigenen Menschen gefunden, ich möchte nicht über uns als Monolith sprechen, weil wir alle sehr unterschiedlich sind, es gibt viele verschiedene Kulturen und Nationen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Indigene Menschen im Allgemeinen sehr lustig sind. Wirklich witzige Leute, und ich denke das existiert einfach von selbst. Einfach… wir haben Humor in unseren Knochen. Ein anderer Teil davon, diese Idee, ihn mit vielleicht dunkleren Momenten zu paaren, ist, dass die Trauer irgendwie immer mit uns lebt. Es gibt ein generationenübergreifendes Trauma, mit dem wir umgehen, es gibt das ständige Trauma des täglichen Lebens in einer kolonialen Welt, die immer noch versucht, uns und unser Volk und unsere Rechte auszurotten. Das ist ein alltägliches Trauma mit dem wir umgehen müssen und wenn wir uns die ganze Zeit darauf konzentrieren, denke ich, dass das ein sehr schneller Weg ist, um sicherzustellen, dass diese Zerstörung passiert, also machen wir stattdessen Witze darüber. Und ich weiß nicht, ob „Abwehrmechanismus“ das richtige Wort ist, aber es ist irgendwo in der Nähe davon.
Sylvia Cunningham: In „Good Bones“, während sich die Figur vorstellt, wie Menschen, die sie liebt oder kennt, sterben werden, entwirft sie auch deren Grabreden. Ich habe mich gefragt, während du dieses Stück Fiktion geschrieben hast, ob du über deine eigene Grabrede nachgedacht hast und was die Leute sagen würden. Eine etwas düstere Frage…
Jessica Johns: Ich liebe diese Frage, also mach dir keine Sorgen… ich habe nicht einmal während des Schreibens über meinen eigenen Tod und die Grabrede und solche Dinge nachgedacht, aber ich war in einer Phase, in der ich ziemlich stark über Menschen in meinem Leben nachgedacht habe, die sterben und was ich bei ihren Beerdigungen sagen würde, was eine wirklich seltsame Sache ist. Das ist die Prämisse der Geschichte, diesen seltsamen Zwang herauszuholen. Aber es war auch zu einer Zeit in meinem Leben, als ich mit Trauer zu tun hatte, ich hatte gerade ein paar Freunde verloren… es war eine seltsame Sache, zu dieser Zeit so intensiv über den Tod nachzudenken. Ich hätte wahrscheinlich zur Therapie gehen sollen oder so… stattdessen habe ich es aufgeschrieben.
Sylvia Cunningham: Das ist lustig, dass du das sagst, denn es gibt den Therapeut*innen in der Geschichte. Eine andere Zeile, die ich mir notiert habe, ist: „‘Vielleicht solltest du wieder zu Dr. Boxma gehen‘, schlägt Mom vor. Dr. Boxma war eine wunderbare Frau, die wirklich ihr Bestes gegeben hat, aber man kann einer Person mit einem perfekt symmetrischen Gesicht einfach keine seltsamen Dinge zugestehen.“
Jessica Johns: Ich meine, das ist einfach wahr! Wenn jemand zu perfekt ist, ist es wirklich schwer, abnormale Dinge zu sagen. Verstehst du?
Sylvia Cunningham: Absolut… weil du diese Geschichte zu einer Zeit geschrieben hast, in der du beschreibst, dass es diese Parallelen in deinem Leben gab, findest du – weil du erwähntest nicht mit einem Therapeuten gesprochen zu haben – dass das ein konstruktiver Weg war, um auf diese Umstände vorbereitet zu sein, sich Dinge vorzustellen und diese Szenarien irgendwie durchzuarbeiten oder war das nur eine Art, wie du es verarbeitet hast und du kannst gar nicht sagen, ob es am Ende wirklich geholfen hat oder nicht?
Jessica Johns: Hmm… ich weiß nicht, ob es am Ende geholfen hat oder nicht. Damals habe ich auch gerade erst angefangen… das war eines der allerersten Dinge, die ich veröffentlicht habe und ich habe gerade erst angefangen bewusster zu schreiben – bewusster in dem Sinne, dass ich versucht habe, als Schriftstellerin zu schreiben und nicht nur als „heimliche Schriftstellerin“, wie ich es vorher irgendwie getan habe, nur für mich selbst zu schreiben.
Sylvia Cunningham: Moment, was meinst du damit, eine heimliche Autorin?
Jessica Johns: Also dieses Stück war etwas, das ich geschrieben habe und dachte, ich schreibe das, um es zu verschicken und zu versuchen, es irgendwo zu veröffentlichen. Heimlich wäre wie vorher, als ich schrieb und dachte: „Ich zeige das niemandem, das ist für niemanden sonst, das ist nur für mich und meine eigenen Zwecke.“ Für andere wäre ich keine Schriftstellerin, weil niemand wüsste, dass ich diese Arbeit mache. Ich weiß nicht, denn ich verarbeitete eine Menge Gefühle und Emotionen in diesem Stück, aber ich war mir auch sehr bewusst, dass ich es schrieb, um es in die Welt hinauszutragen. Ich schrieb es, um es zu veröffentlichen, also war ich vorsichtig, um nicht zu roh zu sein, indem ich es immer noch mit vielen fantastischen Elementen durchtränkte, um eine Art Schutzschild zwischen dem Werk und meiner eigenen Verarbeitung und meinen Gefühlen zu errichten.
Sylvia Cunningham: Als du den Übergang von der „heimlichen Autorin“ zur veröffentlichten Autorin vollzogen hast, waren da Leser*nnen im Kopf, die du dir beim Lesen deiner Arbeit vorstellen konntest?
Jessica Johns: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich für mich selbst schreibe, dass ich Geschichten schreibe, die ich selbst lesen wollen würde. Denn ich liebe Fantasy und ich liebe magischen Realismus und wirklich schräge Geschichten. Ich liebe Horror, groteske Elemente und so lese ich eine Menge davon. Ich würde gerne Cree-Leute in diesen Geschichten sehen, also habe ich das Gefühl, wenn ich schreibe, schreibe ich Bücher, die ich mögen würde. Ich versuche Dinge zu schreiben, von denen, wenn ich mich selbst nicht kennen würde und dieses Buch in die Hand nähme, ich begeistert sein würde.
Sylvia Cunningham: In einem Artikel, der im Toronto Star erschienen ist, sagte deine Agentin Stephanie Sinclair über deine Arbeit… „In vielerlei Hinsicht normalisiert und vermenschlicht [Johns] die Erfahrung der Indigenen Bevölkerung in der Stadt auf eine Art und Weise von der ich denke, dass sie herausfordert, wie Menschen über stereotype Indigene Menschen denken. Ich denke, dass sie auch einen Einblick und eine Perspektive auf die Freude bietet, die in vielen indigenen Familien existiert, von denen wir nicht genug hören.“ Stimmst du mit dieser Einschätzung überein? Ist das ein Ziel oder einfach der Effekt?
Jessica Johns: Ich denke, das ist ein Effekt, weil ich nicht danach strebe, eine städtische Indigene Erfahrung zu repräsentieren. Besonders weil es so viele verschiedene Arten von Indigenen Erfahrungen gibt, aber ich denke, worauf sie hinaus will ist, dass es so viele verschiedene Arten von Indigenen Erfahrungen gibt und eine Indigene Millennial, die in der Stadt lebt, das ist eine Erfahrung. Über Indigenität zu schreiben oder einfach nur ein*e Indigene*r Schriftsteller*in zu sein, über Dinge zu schreiben, muss einfach nicht auf eine bestimmte Art und Weise sein. Ich denke, was Stephanie an meinem Schreiben schätzt, ist, dass ich versuche echt zu sein. Ich versuche, aus einer Erfahrung heraus zu schreiben, die ich kenne und nicht aus einer, die ich nicht kenne. Das bedeutet, dass eine Indigene Person, die viel Zeit verplempert, wenn sie versucht herauszufinden wie man schmiert, weil das eine traditionelle Lehre ist, die ihr nicht wirklich beigebracht wurde als sie aufwuchs, obwohl sie in ihrer Gemeinschaft aufgewachsen ist. Weißt du, sie stolpert durch das Lernen von Dingen und stolpert durch die Verbindung zu ihrer Familie, weil Dinge passiert sind, die diese Verbindungen ein wenig zerbrochen und durchtrennt haben. Aber ihre Gemeinschaft und Familie ist immer noch so wichtig. Ich denke also, obwohl das sicherlich kein Ziel ist, dass das Schreiben aus einer Erfahrung heraus, die ich kenne, hat Resonanz gefunden.
Sylvia Cunningham: Hast du eine typische Schreibroutine?
Jessica Johns: Ja, ich bin keine Morgenschreiberin, ich habe es versucht. Ich habe versucht die Person zu sein, die früh aufsteht, sich einen Kaffee macht und schreibt. Aber das funktioniert nicht, mein Gehirn funktioniert nicht so. Als ich dann anfing das Buch zu schreiben und vor allem, als ich es bearbeitete, war meine Routine so, dass ich maximal zwei bis drei Stunden daran arbeiten konnte, weil es sehr viel und anstrengend ist. Es braucht viel mentale Energie, also mache ich das am Nachmittag und arbeite danach an anderen oder leichteren Sachen. Aber ich tue das jeden Tag. Wenn ich eine Pause mache, dann ist es, als ob ein Rad von einem Auto abgefallen ist und dann kann alles passieren… Also halte ich mich an diese Routine und ich habe auch gemerkt, dass ich beim Schreiben diese Routine zufällig aufgeschnappt habe. Aber ich habe mir angewöhnt jeden Abend zu lesen und gleich nachdem ich mit dem Lesen fertig bin, lege ich mein Buch weg und schreibe dann auf meinem Telefon eine halbe bis eine Stunde lang, weil Lesen so eine große Hilfe ist. So liege ich im Bett, nicht an meinem Computer, mit meiner Notizen-App und schreibe einfach und gehe dann ins Bett. Ein großer Teil meines Romans wurde in meiner Notizen-App geschrieben.
Sylvia Cunningham: Stellst du fest, dass du – weil du verschiedene Autor*innen direkt vor dem Schlafengehen und direkt vor dem Schreiben liest – auf Abschnitte zurückblickst, die du geschrieben hast und denkst: „Oh OK, das war definitiv nach dem Lesen von XY“
Jessica Johns: Auf jeden Fall. Oh ja. Ich habe Eden Robinson gelesen, das letzte „Trickster“-Buch aus ihrer Serie. Es ist wirklich grotesk, es gibt jede Menge Körperhorror. Und ja, es gab ein paar Szenen, die ich wieder gelesen habe und dachte: „Wow, da war ich tief in der Eden-Robinson-Spirale.“
Sylvia Cunningham: Abgesehen davon, dass du deinen Debütroman geschrieben hast, bist du auch geschäftsführende Herausgeberin des Room Magazine, der ältesten feministischen Literaturzeitschrift Kanadas. Was waren deine Ziele als du die Leitung übernommen hast?
Jessica Johns: Es gab ein paar Dinge, die ich unbedingt tun wollte, als ich das Amt übernahm. Die Chefredakteurin vor mir, Chelene Knight, war eine wirklich wunderbare Mentorin für mich. Ich wollte wirklich ein Erbe aufrechterhalten. Sie hatte es bereits begonnen. Sie hatte implementiert und versucht sicherzustellen, dass die Struktur, also ein Team von Kollektivmitgliedern, von Freiwilligen, von Mitarbeiter*innen sich weiterentwickelt. Alles drehte sich um Beziehungen –Beziehungen untereinander, Beziehungen zu unseren Autor*innen, zu unserem Vertrieb, zu Organisationen, mit denen wir bei Projekten zusammenarbeiten. Und diese waren einfach wirklich… die literarische Welt kann wirklich kalt sein, besonders diese Organisationen, die auf Kapitalismus aufgebaut sind, in dem wir alle nur Rädchen sind. Ich glaube, sie wollte, dass Room etwas anderes verkörpert und sich auf eine andere Weise bewegt.
In diesem Sinne wollte ich wirklich ein paar Dinge tun. Ich hatte bei Room mit der Lesereihe „Indigenous Brilliance“ begonnen und wollte sie ernsthafter in die Dynamik von Room einbinden, denn zu der Zeit, vor zwei Jahren, war sie noch eine Art Offset unter dem Dach von Room. Es war eine Lesereihe, die stattfand, aber ich wollte mehr Projekte fördern, die Indigene Stimmen in den Mittelpunkt stellen, die Schwarze Stimmen in den Mittelpunkt stellen. Das ist eines der Dinge, von denen ich glaube, dass wir sie in einem wirklich positiven Maße umgesetzt haben. Wir haben so viele wunderbare Projekte mit Indigenous Brilliance, die bewusst in die Struktur von Room eingeflochten sind, anstatt nur ein Ableger zu sein. Und dann haben wir auch unsere Systeme neu bewertet, denn jede einzelne Literaturzeitschrift ist von Natur aus auf einem kolonialen System aufgebaut, da alles, von unseren Stilrichtlinien bis hin zu der Sprache, die wir verwenden, Englisch, eine koloniale Sprache ist. Und so wollte ich wirklich alles was wir tun in Frage stellen und unterbrechen und überlegen, wie wir diese Systeme, diese Richtlinien, diese Leitfäden, diese Ressourcen aktualisieren können, um anti-diskriminierende Praktiken einzubauen. Das ist eine Menge Arbeit im Hintergrund, aber es ist strukturell und ich habe das Gefühl, dass wir als Redakteur*innen von Ressourcen lernen, die anti-diskriminierende Praxis in den Mittelpunkt stellen und nicht nur die Grammatik, das ist ein wirklich bedeutender Akt in der Redaktion und im Zeitschriftenverlag. Und ja, der Versuch diese Dinge zu tun war eine ziemlich bedeutende Menge an Arbeit und Lernen und Verlernen von meiner Seite aus.
Sylvia Cunningham: Wenn du diese Styleguides dekonstruierst, treten dann neue Styleguides an ihre Stelle und was sind dann die neuen Regeln oder gibt es neue Regeln?
Jessica Johns: Nein, nein, es gibt immer noch Regeln. Es ist mehr eine Art an das Editieren heranzugehen, der Style Guide existiert immer noch, er ist nur anders. Zum Beispiel war eines der Dinge, die in allen Style Guides zu finden waren, dass man nicht-englische Wörter kursiv setzen musste. So war ein Bruch darin, dass man das nicht tun muss, es ist den Autor*innen überlassen, ob sie das möchten. Und es wurde in den Styleguide aufgenommen, wie Unterdrückung im Schreiben aussieht, so dass man in der Lage ist zu erkennen, wenn diskriminierende Sprache verwendet wird. Also einige Metaphern und solche Dinge können ziemlich rassistisch oder transphob oder frauenfeindlich sein. Es ist eine Sprache, die wir als selbstverständlich hinnehmen oder wir sind uns dessen einfach nicht bewusst. Sie hat sich so sehr in unsere Sprache, in unser Lexikon eingeprägt, dass wir sie nicht bemerken. Die Leute schreiben also darüber und dann kommt es zu uns und anstatt nur so etwas zu haben wie: „So erkennst du ein falsch gesetztes Bestimmungswort“, ist dies ein Styleguide, der wie folgt lautet: „So erkennst du potenziell rassistische Sprache“ – zum Beispiel. Hier ist, wie du das ändern kannst oder hier ist, wie du das Gespräch mit d* Autor*in führen kannst, d* das wahrscheinlich nicht absichtlich gemacht hat. Es ist also eher so. Wir haben nicht alle Antworten, denn es gibt keine Möglichkeit, alles zu identifizieren, was möglicherweise auftauchen könnte. Es ist eher eine Art, an die Bearbeitung heranzugehen. Es ist eine Veränderung der Art und Weise, wie wir das Editieren betrachten müssen, denke ich. Es gibt einen Indigenen Stilratgeber, der von dem verstorbenen Gregory Younging geschrieben wurde und ich denke, dass diese Praxis wirklich nach diesem Buch modelliert ist, in dem er gleich zu Beginn sagt, dass dies keine Anleitung ist, dass dies nicht alle Antworten geben wird, sondern eine Art aufzeigt, an diese Dinge heranzugehen, eine neue Art des Hinterfragens, des Denkens über eine neue Beziehung zur Sprache und diese Art von Dingen. Es ist eine Öffnung. Um das zu erreichen, hat sich der Style Guide geändert.
Sylvia Cunningham: Du hast erwähnt, dass du Co-Kuratorin der Indigenous Brilliance Lesereihe in Vancouver bist, die die Werke von Indigenen Frauen, Two Spirit und queeren Autor*innen hervorhebt. Ich kann mir vorstellen, dass du mit vielen dieser Autor*innen bereits vertraut bist, aber du lernst wahrscheinlich auch ständig neue Schriftsteller*innen kennen. Da habe ich mich gefragt, ob du uns ein paar Empfehlungen geben könntest.
Jessica Johns: Ja, absolut. Ich liebe es, Empfehlungen zu geben, vor allem von Indigenen Autor*innen und queeren Indigenen Autor*innen. Das Buch von Jaye Simpson „It was never going to be okay“ ist letztes Jahr herausgekommen und es ist absolut brillant. Es ist ein Gedichtband. Sie ist ein Mitglied des Indigenous Brilliance Teams und ein fantastischer Mensch. Selina Boan hat gerade einen Gedichtband mit dem Titel „Undoing Hours“ veröffentlicht. Molly Cross-Blanchard hat gerade einen Gedichtband namens „Exhibitionist“ veröffentlicht. Und natürlich kennt und liebt jede*r Billy-Ray Belcourt und sein neuestes Sachbuch „A History of My Brief Body“, das für zahlreiche Preise nominiert ist und immer wieder großartig ist. Eden Robinson hatte ich schon erwähnt und die Trickster-Serie. Eine sehr prägende Serie für mich und meine Arbeit, und ihre Mentorinnenschaft war auch sehr einflussreich.
Sylvia Cunningham: Das war Jessica Johns, die leitende Redakteurin des Room Magazine, deren Debütroman „Bad Cree“ im Frühjahr 2023 bei HarperCollins Canada erscheinen soll. Ein großes Dankeschön an alle meine Interviewgäste, die sich die Zeit genommen haben, mit mir über diese Serie zu sprechen – Carmen Robertson, Martina Weinhart, Caroline Monnet, Jocelyn Joe-Strack und Jessica Johns. Vielen Dank auch an meine Freundin und Künstlerin Miranda Holmes, die mir als Resonanzboden diente und mir erlaubte, sie vor der allerersten Folge von „Critical Land“ zu befragen. Die Ausstellung „Magnetic North“ wurde bis zum 29. August verlängert, so dass ihr noch etwas Zeit habt zu schauen, was tatsächlich an den Wänden der Galerie zu sehen ist, darunter Arbeiten von Caroline Monnet, Lisa Jackson und eine Auswahl von 90 Gemälden und 40 Skizzen der Group of Seven, die zum ersten Mal in Deutschland gezeigt werden.
SCHIRN Podcasts kostenlos abonnieren und auf dem Handy oder Tablet herunterladen.
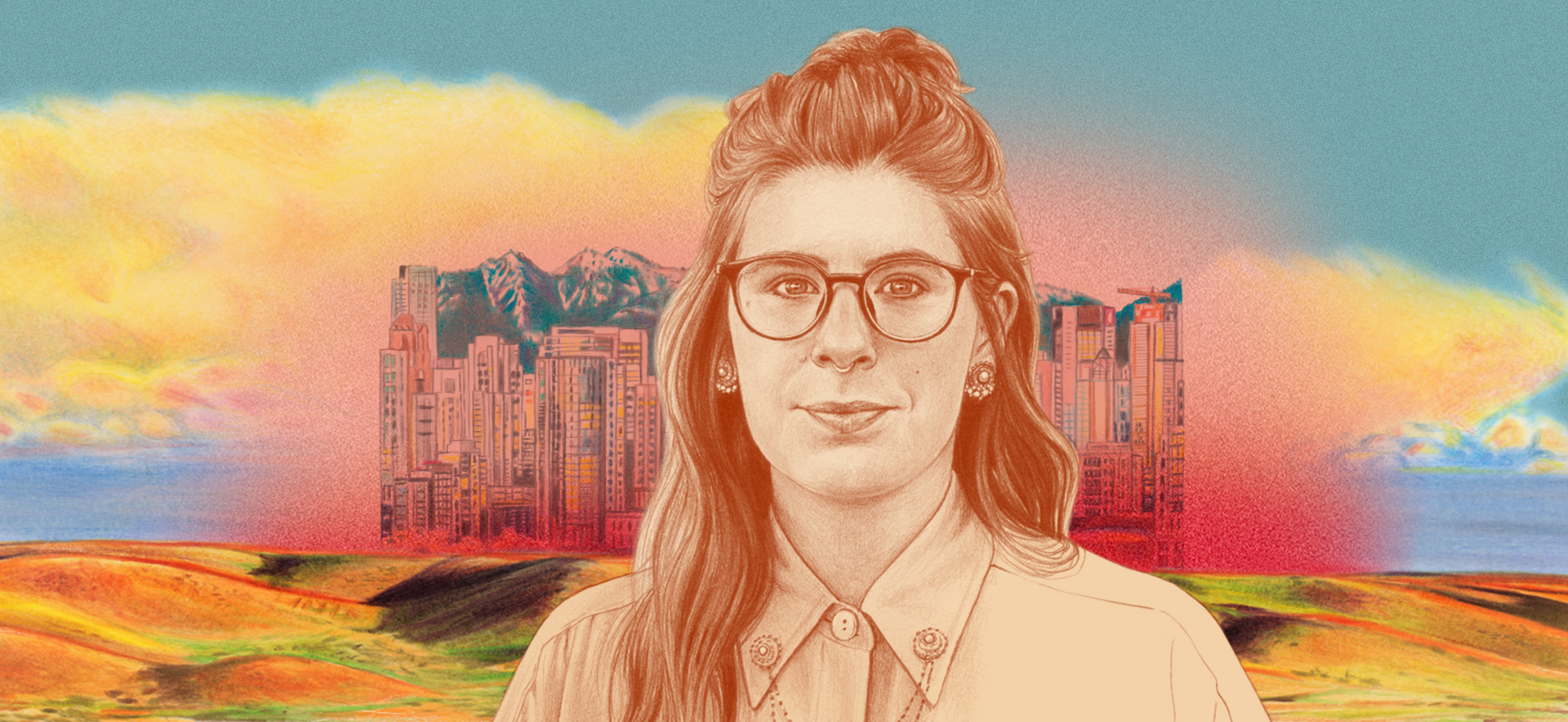
Das könnte Sie auch interessieren
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt.








