Critical Land.
Indigene Kunst und Identität
19.04.2021
36 min Lesezeit
Im Gespräch mit der Algonquin-Französischen Künstlerin Caroline Monnet. Die englische Podcast-Reihe mit Indigenen Perspektiven auf Kunst, Natur, Dekolonialisierung und Klimawandel.
Transkript
Sylvia Cunningham: Willkommen bei „Critical Land“. Ich bin eure Moderatorin Sylvia Cunningham. Dies ist die zweite Episode eines englischsprachigen Podcast der Schirn, parallel zur Ausstellung „Magnetic North: Imagining Canada in Painting 1910-1940“. In dieser Podcast-Serie „Critical Land“ greifen wir einige Themen der Ausstellung „Magnetic North“ auf, um über das hinauszugehen, was an den Wänden der Galerie zu sehen ist. Durch Interviews mit Indigenen Künstler*innen, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen stellen wir Verbindungen zwischen der Ausstellung und heutigen Kunst- und Umweltbewegungen her. Die Ausstellung untersucht die moderne kanadische Landschaftsmalerei aus einem zeitgenössischen Blickwinkel. Sie zeigt auch den Film „How a People Live“ der Anishinaabe-Filmemacherin Lisa Jackson und „Mobilize“ der Algonquin-französischen Künstlerin Caroline Monnet, von der ihr in der heutigen Folge hören werdet. Monnets immersive Videoinstallation „Transatlantic“ ist zeitgleich in der öffentlich zugänglichen Rotunde der Schirn zu sehen. Ein kurzer Hinweis – wir haben in der ersten Folge von „Critical Land“ mit der Kuratorin der Ausstellung, Martina Weinhart, und der Lakota-schottischen Kunsthistorikerin Carmen Robertson über die Group of Seven gesprochen. Wenn du diese Interviews noch nicht gehört hast, kannst du das hier nachholen. Und nun zur heutigen Folge. Caroline Monnet ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die in Montreal lebt. Sie wuchs sowohl in Gatineau, Québec, als auch in der Bretagne, Frankreich, auf. Ihre Mutter ist Algonquin, ihr Vater Franzose und sie arbeitet mit vielen verschiedenen Medien, darunter Film, Skulptur, Installation und Malerei.
[O-Ton „Mobilize]
Was du jetzt hörst, ist die Audiospur aus Monnets Kurzfilm „Mobilize“, eine der Arbeiten, die in der Schirn zu sehen ist. Der Film hat ein unglaublich treibendes Tempo, von der Musik, die von Tanya Tagaq gespielt wird, bis hin zu den Aktionen, die wir vor der Kamera sehen. Da ist ein Mann, der meisterhaft durch das Wasser paddelt, andere schälen Birkenrinde, um ein Kanu zu bauen. Wir sehen auch Szenen in der belebten Stadt, darunter Mohawk-Eisenarbeiter, die auf Stahlträger klettern. Ich habe Caroline Monnet gefragt, wie dieser Film entstanden ist.
Caroline Monnet: 2015 trat das National Film Board of Canada an mich heran, um Material aus ihren Archiven aufzuarbeiten. Das war Teil ihrer „Souvenir“-Reihe. Wir waren also vier Filmemacher aus ganz Kanada, die ein dreiminütiges Video mit ihren Archiven machen sollten. Die einzige Anweisung, die sie uns gaben, war die Indigene Identität darzustellen, was ich für eine sehr abstrakte Sache hielt, denn für mich gibt es viele Indigene Realitäten. Ich hatte Zugang zu über 800 Filmen, von denen die meisten natürlich aus einer weißen, männlichen Perspektive gedreht wurden, die sich den Indigenen Völkern aus einem anthropologischen Blickwinkel nähern, in dem die Protagonisten immer als sehr passiv dargestellt werden, irgendwie damit beschäftigt, an ihrem Handwerk zu arbeiten und wirklich darauf bestehen, am Rande der kanadischen Gesellschaft zu bleiben. Es gibt also eine Art Spannung zwischen dem ursprünglichen Filmmaterial, das in einer Zeit des historischen Chaos und der kolonialen Behandlung der Indigenen Bevölkerung entstanden ist, und dem Remix, den ich in „Mobilize“ gemacht habe. Denn ich habe diese Bilder, diese Filme benutzt, um zur Mobilisierung der Indigenen Bevölkerung im ganzen Land aufzurufen. Weil für mich Indigene Identität etwas Lebendiges und Dynamisches ist. Es ist nicht etwas Passives, wie es in diesen Filmen gezeigt wird. Ja, und ich wollte einfach, dass sich das Publikum angeregt fühlt, wenn Indigene Menschen auf der Leinwand ihre Fähigkeiten zeigen. Deshalb war ich besonders an Bildern von Menschen interessiert, die laufen oder bauen, Kanu fahren, die sich einfach vorwärtsbewegen. Für mich ist das wirklich ein Gegenpol zu der Trägheit, die in den kanadischen Medien oft dargestellt wird.
Sylvia Cunningham: Selbst die Tatsache, dass du eingeladen wurdest, dies im Rahmen der „Indigenen Identität“ zu tun – was dieser Begriff ist, der singulär ist, er ist monolithisch – wie hast du dich dem genähert? Hast du dich von deinem persönlichen Hintergrund aus genähert oder wie konntest du vermitteln, dass es unmöglich ist, dies auf eine monolithische Sichtweise herunterzubrechen?
Caroline Monnet: Man kann es nicht auf eine monolithische Sichtweise reduzieren, weil es mehrere Realitäten Indigener Identität gibt, und es gibt so viel Vielfalt innerhalb der großen Indigenen Gemeinschaft selbst in ganz Kanada. Ich wusste, dass ich nicht in den nostalgischen Bereich der Auswahl von Schwarz-Weiß-Filmen gehen wollte. Deshalb entschied ich mich für 16-mm-Farbmaterial, um diese Art von Konsistenz vom Anfang bis zum Ende des Films zu erreichen und dem Publikum das Gefühl zu geben, dass ich den Film selbst gedreht habe. Und man fängt an, mehr auf die Textur und die Farben zu achten und jedes Bild zusammenzusetzen, fast wie ein Puzzle, nur dass man nicht weiß, wie das Bild am Ende aussehen wird. Man setzt es einfach zusammen und fängt irgendwie an, mit all dem eine Erzählung zu finden. Ich denke, in gewisser Weise repräsentiert der Film auch meine eigene Familiengeschichte. Ich bin nicht in der Gemeinde meiner Mutter aufgewachsen, aber über die Generationen hinweg hat sie sich auf dem Land entwickelt. Und ich denke, es gibt ein gewisses Maß an Privilegien, das mit der Migration in die Stadt einhergeht, natürlich den Zugang zu Jobs und Bildung, aber mit diesem Privileg kommt auch ein gewisses Maß an Assimilation und Trauma und Vertreibung. Man beginnt, in diesen Städten eine neue Geschichte aufzubauen. Das hat mich wirklich fasziniert und die Vorstellung von Arbeit, die in der Stadt ganz anders ist als auf dem Land und nicht die gleichen Fähigkeiten und Kenntnisse erfordert. In dem Film ging es also wirklich darum aufzuzeigen, wie Indigene Menschen die kanadische Gesellschaft mitgestaltet haben, ich meine bis hin zum Bau von Wolkenkratzern in unserer Stadt. Also ging es darum zu sagen, dass unsere Präsenz als Indigene Menschen nicht länger ignoriert werden kann.
Sylvia Cunningham: Du erwähnst, dass du den Umfang auf 16-mm-Farbmaterial eingegrenzt hast. Wie viele Stunden Film waren das damals, die dir zur Verfügung standen, um damit zu arbeiten?
Caroline Monnet: Ich meine, ich hatte Zugang zu 800 Filmen, aber ich fing an, Schlüsselwörter einzugeben, weil man sie natürlich nicht alle sehen kann, und die Schlüsselwörter drehten sich um „Bauen“ und „Gehen“ und „Indigene, die gehen“, „Indigene, die laufen“, „Indigene, die bauen“. Ich wollte die Idee, in Aktion zu sein und kein passives Volk zeigen. Wir sind nicht in der Zeit stehengeblieben, wir sind sehr aktiv und wir haben eine Reihe von Fähigkeiten, die, wie du weißt, tatsächlich sehr gefeiert werden. Wir sind Teil dieser Gesellschaft, dieser pulsierenden Gesellschaft, und wir haben unseren Platz darin. Das wollte ich zeigen, also muss man ganz instinktiv mit diesem Prozess arbeiten, mit Archiven arbeiten. Der Soundtrack von Tanya Tagaq spielte auch beim Schnitt eine wichtige Rolle spielte, um diese Energie zu erzeugen. Ihre Musik hat diese traditionelle Verbindung und ist gleichzeitig sehr zeitgenössisch, fast wie Metal-Musik. Ich fand es wirklich interessant, die Archive zu nutzen, um über die Zukunft zu sprechen, und ihre Klänge halfen dabei, diese Brücke zu schlagen.
Sylvia Cunningham: Okay, das kam also relativ früh im Prozess? Das wollte ich gerade fragen. Wusstest du, dass du die Musik von Tanya Tagaq verwendest möchtest und das Filmmaterial darauf abstimmen würdest, um das treibende Tempo des Titels aufzubauen und zu ergänzen?
Caroline Monnet: Ja, absolut. Ich hatte Zugang zu ihrem Album und ich wählte den peppigsten Track des Albums, weil mir von Anfang an klar war, dass ich – weil es nur drei Minuten sind – diese Erfahrung machen wollte, eine Erfahrung für die Zuschauer*innen schaffen wollte, bei der sie fast an den Computer angeschlossen sind und von Bildern bombardiert werden und dann ihr Herz anfängt zu pochen, und sie würden außer Atem sein und sie wären total angetrieben, wenn sie Indigene Menschen sehen, die auf der Leinwand so abgehen. So verstehen sie nicht wirklich, was gerade mit ihnen passiert ist, aber sie haben dieses Maß an Energie. Diesen Effekt mit der Darstellung Indigener Menschen auf der Leinwand zu erzeugen, war die Hauptabsicht hinter dem Film.
Sylvia Cunningham: Es ist so hypnotisierend und faszinierend zu beobachten, was jede*r macht – es ist wirklich so viel los. Im Gegensatz dazu steht deine andere Arbeit, die gerade in der Schirn zu sehen ist, deine Videoinstallation „Transatlantic“, die ganz ohne menschliche Präsenz auskommt. Für diese Arbeit, von der wir jetzt ein wenig Audio hören, hast du dich in einem Hafen in Europa auf ein Frachtschiff begeben und bist dann nach Montreal gereist, wo du jetzt lebst. Kannst du beschreiben, wie diese Reise für dich war?
Caroline Monnet: Nun, „Transatlantic“ ist eine Reise, die ich 2012 auf einem Frachtschiff vom holländischen Hafen IJmuiden, etwas westlich von Amsterdam, bis nach Montreal an den Großen Seen in Nordamerika unternommen habe. Ich brauchte 22 Tage, um den Atlantik zu überqueren. Die ganze Reise wurde mit einer Mini-DV-Handkamera dokumentiert. Ich denke, das Video transportiert verschiedene Gefühlszustände, die ich auf See empfunden habe, wie starke Anspannung, Nervosität, Langeweile und sogar manchmal ein bisschen Angst, wenn wir auf Stürme trafen, aber auch, weil ich mich in einem männerdominierten Umfeld der Schifffahrt und Industrie befand. Es gab also Momente, in denen ich mich fragte, warum ich diese Reise überhaupt machen wollte. Aber der ursprüngliche Gedanke dahinter ist, dass der transatlantische Ozean für mich ein Mittelweg war, auf dem sich meine beiden Vorfahren trafen. Es war eine Art symbolischer Ort, und diese Idee von Grenzen, ob sie nun physisch oder metaphorisch sind, war in meinen Arbeiten immer sehr präsent. Also ist es eine Fortsetzung dieser Idee. Ich bin zwischen zwei Kontinenten, zwei Kulturen aufgewachsen, also war ich fasziniert von dieser Idee der Dualität und wie politische und soziale Geschichten unsere Identität formen. Wir sagen immer, dass die Identität dem Territorium innewohnt, aber was bedeutet es, wenn man aus zwei unterschiedlichen Territorien kommt, wie formt das die Identität? Das war also sozusagen die Saat hinter dem Projekt. Aber das Projekt entwickelte sich weiter, denn ich habe es 2012 gedreht, doch ich habe gut sechs Jahre gebraucht, um es fertigzustellen. Ich habe es 2018 fertiggestellt und bin froh, dass es ein wenig gereift ist, denn dann begann das Projekt, den Atlantischen Ozean als fortwährende koloniale Bewegung und wirtschaftlichen Austausch zwischen Europa und Nordamerika zu untersuchen, wie die Kolonisierung ein historisches Ereignis ist, das durch den transatlantischen Sklavenhandel und den Völkermord an den Ureinwohnern definiert wird, sodass es ein viel einnehmenderes Stück wurde als nur ein persönliches.
Sylvia Cunningham: Was, glaubst du, war es in den sechs Jahren dazwischen, dass sich dieser Rahmen und diese Erzählung entwickeln konnten? War es eine Frage der Recherche oder anderer Projekte, die deine Überlegungen dazu beeinflusst haben?
Caroline Monnet: Ich schätze, es ist einfach so, dass ich die Reise gemacht habe und dann lagen die Bänder lange Zeit im Regal, ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich hatte keine klare Vorstellung davon, was ich damit machen sollte. Ich wusste, dass ich nicht wollte, dass es nur ein dokumentarisches Stück wird, und deshalb habe ich alle Männer bei der Arbeit in dem Stück entfernt. Es ist sehr abstrakt, es wird fast wie ein Schiff, das über eine große Kluft reist. Es ist eher eine Erfahrung als ein Dokument, und es war mir sehr wichtig, damit eine immersive Erfahrung zu schaffen, und dafür habe ich so lange gebraucht, ich weiß nicht, warum. Weißt du, „Mobilize“ war in nur einem Monat fertig, von Anfang bis Ende, vom Konzept bis zur Auslieferung des Produkts, und für „Transatlantic“ habe ich sechs Jahre gebraucht. Ja, ich glaube, ich brauchte eine gewisse Reife als Künstlerin und Denkerin, um mir eine Art Installation vorzustellen und nicht nur ein Dokument, das auf Filmfestivals läuft. Oder ich musste mich persönlich weiterentwickeln, glaube ich auch.
Sylvia Cunningham: Was wir am Anfang des Films sehen, ist diese eher industrielle Szene mit Schornsteinen und dann am Ende der Reise sehen wir eine Stadtlandschaft bei Nacht, natürlich mit vielen Gebäuden. Ich hatte das Gefühl, dass diese Bilder sehr verankernd sind, weil ich genau weiß, wo ich bin. Aber es ist die Zeit dazwischen, wo es einfach nur offenes Wasser ist, wo man sich total hineingesogen fühlt, wo man das Gefühl hat, sich zu verlieren. Ich frage mich, ob das ein bisschen daran erinnert, wie es für dich während der dreiwöchigen Reise war. Du warst ziemlich isoliert, richtig? Ich meine, wie war es, draußen auf dem offenen Meer zu sein, wo es, wie du sagtest, nur Interaktion mit der Crew gab – gab es überhaupt eine Verbindung zur Außenwelt während dieser 22 Tage?
Caroline Monnet: Nein, niemand wusste, wo ich war, was ein interessantes Konzept war, es stimmt, man hat keine Verbindung zu Telefon oder Internet, also ist man wirklich 22 Tage lang auf dem Meer und es ist eine Art Zeittasche, die… man kann nirgendwo hingehen, man ist, wo man ist. Das ist eine sehr interessante Erfahrung, alle deine Bezugspunkte verschwinden, weil es keinen Punkt gibt, keine Markierungen am Horizont, es ist immer das Gleiche. Man gerät also in einen anderen Geisteszustand, was ein sehr faszinierender Ort ist.
Sylvia Cunningham: Etwas, das meine Mutter sagt, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihr zustimme, aber sie sagt, dass der beste Teil einer Reise der Teil davor ist, also die Planungsphase, die Vorfreude auf alles, die Vorfreude auf die Reise. Und der Teil danach, die Erinnerungen daran und das Wiedererleben der Reise. Was waren deine Gefühle bei der Ankunft in Montreal? Die erste Nacht, in der du wieder in deinem Bett lagst, warst du erleichtert oder hat ein Teil von dir bereits davon geschwärmt, wieder auf dem offenen Meer zu sein. Wie hat sich deine Rückkehr angefühlt?
Caroline Monnet: Ja, ich denke, es gab eine gewisse Romantisierung der Idee, den Atlantik zu überqueren. Es ist die mythologische Route, wie mein Vater nach Frankreich kam und nach Kanada auswanderte, und so viele andere Leute, so viele andere Generationen und Erfahrungen von Siedlern. Aber ja, natürlich war ich ekstatisch, als ich in Montreal ankam, um endlich einen Fuß auf Land zu setzen, denn es ist eine lange Reise, man sehnt sich nach den Menschen, nach der Verbindung zu den Menschen, die man liebt. Also ja, es war eine interessante Reise, aber… ich bin mir nicht sicher, ob ich deiner Mutter in diesem Punkt zustimme. Es hat etwas, von Punkt A nach Punkt B zu gehen, und die Reise ist das, was faszinierend ist, wie man als Person wächst, und die Idee, eine Grenze zu überschreiten oder so. Die Reise selbst ist interessant, ja.
Sylvia Cunningham: Deine beiden Werke werden in der Schirn zur gleichen Zeit gezeigt wie die Arbeiten der Group of Seven, die zum ersten Mal in Deutschland ausgestellt werden. Wie hast du über diesen Kontext nachgedacht, vor allem in dem Wissen, dass die Besucher*innen mit diesen verschiedenen Dimensionen der Kunst konfrontiert werden, die von Menschen aus Kanada stammen.
Caroline Monnet: Nun, wenn man in Kanada aufwächst, ist die Group of Seven so etwas wie die erste Referenz, die man mit Malerei und kanadischer Kunst im Allgemeinen hat. Jedes Kind in Kanada ist damit aufgewachsen. Man kennt all die großen Maler wie Rembrandt und Picasso, aber man kennt auch die Group of Seven, sodass wir Kanada durch diese Gemälde verstehen lernen. Man versteht die Darstellung der kanadischen Landschaft vor allem durch diese Gemälde. Aber ich denke, meine Interpretation davon ist, dass diese Gemälde, die dazu beigetragen haben, eine Geschichte zu erzählen, die sich sehr von den Indigenen Perspektiven unterscheidet, weil es um dieses unberührte, unbewohnte Superterritorium ging, das darauf wartete, entdeckt zu werden. Weißt du, sie nennen es die „terra nullius“. Diese Indigene Geschichte einfach aus diesen Darstellungen zu entfernen, die Indigene Präsenz aus dieser Geschichte zu entfernen, verewigt den kolonialen Blick. Die Auslöschung Indigener Geschichten und Menschen und auch die Vertreibung Indigener Menschen. Es ist also eine bittersüße Beziehung zu diesen Bildern und der Group of Seven. Technisch gesehen sind sie spektakulär und es ist eine großartige Bewegung, aber gleichzeitig tragen sie zu genau dem bei, wogegen wir kämpfen.
Sylvia Cunningham: Etwas, worüber wir in der ersten Folge von „Critical Land“ mit Professor Carmen Robertson gesprochen haben, war der Unterschied zwischen Land und Landschaft. Was bedeuten diese Begriffe für Sie?
Caroline Monnet: Nun, Landschaft ist für mich eine Repräsentation von Topographie und es ist etwas, das schön ist und das man sich fast vorstellen kann, es ist Teil einer Vorstellung und man kann eine Landschaft beschreiben. Wohingegen Land für mich das ist, wo wir hingehören, es ist das, wo alles seinen Ursprung hat. Wir können die Erde nicht besitzen, es ist die Erde, die uns besitzt, wir kommen von ihr und wir kehren zu ihr zurück. Ich denke, das Land ist der Begriff des Territoriums und das Zentrum aller Menschen, weil dort alle Wurzeln unseres Wissens liegen – unsere Sprachen, unsere Traditionen, unser Gefühl der Zugehörigkeit und unser Identitätsgefühl – also denke ich, dass es mehrere Territorien und mehrere Länder und kanadische Landschaften gibt. Es gibt eine Vielfalt davon, und ich denke, wir können nur von dem Land sprechen, von dem wir kommen. Ich glaube nicht, dass ich für „kanadisches Land“ sprechen kann, ich kenne nur den Ort, aus dem ich komme, und die Region in Kanada, aus der ich komme, und die Verbindung, die ich mit diesem Land im Besonderen habe, und auch die Verbindung meines Volkes zu diesem Land.
Sylvia Cunningham: Ich habe mir ein früheres Interview von dir angesehen, und ich hoffe, ich verstehe, was du gesagt hast. Du sprachst darüber, wie sehr du dich für Indigene Künstler*innen interessierst, die auf verschiedene Kunstbewegungen zurückblicken und sie reflektieren. Wie würdest du deine Perspektive auf die Landschaftsbilder der Group of Seven und die Zeit, in der sie malten, anwenden – auf diese Bewegung?
Caroline Monnet: Wow, das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht, denn es ist eine Bewegung… es ist eine Bewegung an sich, aber wie würdest du diese Bewegung in der Malerei nennen, weißt du, was ich meine? Weil es ziemlich figurativ ist, also bin ich mir nicht sicher, ob es eine Bewegung ist, die ich instinktiv erforschen würde, wie den Modernismus, oder den Dadaismus oder den Surrealismus, wo es eine wirkliche weltweite Bewegung gab. Diese spezielle Gruppe ist sehr spezifisch für Kanada und die Darstellung von Landschaft. Sie sind eine Art Entdecker auf dem Land, richtig? Sie lassen sich auf dem Land nieder und versuchen, es so gut wie möglich darzustellen, fügen aber auch ihren eigenen Siedlerblick hinzu, sodass es auch eine Ebene ihrer eigenen Vorstellungskraft ist, die in die Arbeit einfließt. Das ist also eine wirklich gute Frage, über die ich nachdenken muss, wie ich sie mir aus meiner eigenen Indigenen Perspektive aneignen würde.
Sylvia Cunningham: Du hast sowohl Algonquin als auch französische Wurzeln, und ich habe gesehen, wie du zuvor darüber gesprochen hast, traditionelle Praktiken mit zeitgenössischen Praktiken zu verbinden – dass deine Arbeit oft Brücken schlägt. Hast du deine Algonquin-Herkunft und dein Erbe durch dein eigenes Aufwachsen kennengelernt, oder hast du mehr über diese Geschichte und Traditionen als Künstlerin gelernt, die sich in ihrer Kunst gezielt mit diesen Themen auseinandersetzt?
Caroline Monnet: Nun, ich würde sagen, als Künstlerin habe ich eine Arbeit gemacht, die auf Recherchen basiert. Das hat mir erlaubt, tiefer in diese Begriffe und dieses Wissen einzudringen und mehr darüber zu erfahren, woher ich komme, aber es ist etwas, das immer präsent war, als ich aufgewachsen bin. Es ist nur nicht etwas, worüber man am Küchentisch spricht. Man spricht zu Hause nicht wirklich über seine Kultur oder es ist nicht etwas, das man mit seinen Eltern oder mit seinen Geschwistern oder Tanten und Onkeln zu definieren beginnt. Wenn ich als Künstlerin anfange, mich mit Themen zu beschäftigen, die mir wichtig sind, und bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft zu diskutieren und einen Dialog über bestimmte Themen unserer Gesellschaft zu eröffnen, dann fange ich an, mehr zu graben und mich mit traditioneller Kunst oder traditionellen Lehren zu beschäftigen und einfach mehr zu schauen, woher meine Leute kommen. Und wie ich schon sagte, bin ich in einem Vorort von Ottawa aufgewachsen, also nicht in der Gemeinschaft meiner Mutter, und ich meine, wir sind zu Beerdigungen oder Hochzeiten zurückgegangen, aber das war nichts, was in meiner Kindheit besonders gefeiert wurde. Erst später, als es auch in der kanadischen Gesellschaft ein bisschen akzeptierter wurde, konnte ich ein bisschen tiefer graben.
Sylvia Cunningham: Ist das inzwischen eine Brücke zu deiner Mutter und der erweiterten Familie geworden? Ich meine, ist es etwas geworden, worüber du vielleicht am Küchentisch sprechen würdest?
Caroline Monnet: Ja, vielleicht ein bisschen mehr, weil es jetzt so eingebettet ist in mein Leben und die Arbeit, die ich mache. Also ja, natürlich, wenn meine Mutter mich fragt, woran ich arbeite, erzähle ich ihr mehr darüber oder einfach die Leute, die ich in meinem Umfeld habe. Aber ich denke, es ist eine Art, wie soll ich das sagen? Es hat fast nur vier Generationen gedauert uns mit kulturellem Genozid auszulöschen. Und es ist keine 50 Jahre her, dass es uns nicht erlaubt war, uns kreativ auszudrücken. Also gibt es ein gewisses Maß an Verantwortung, das mit der neuen Generation kommt, in der Lage zu sein, präsent zu sein und diese Traditionen am Leben zu erhalten. Zwischen meinem Großvater und mir klafft eine gewisse Lücke und ich möchte einfach daran arbeiten, diese Lücke zu schließen und das in meine eigene Familie und mein eigenes Umfeld zurückzubringen.
Sylvia Cunningham: Ich würde gerne auf einen weiteren deiner Filme eingehen, „Creatura Dada“. Ich hatte vor, ihn selbst zu beschreiben, aber eigentlich würde ich mich freuen, wenn du stattdessen beschreiben würdest, was dieser Kurzfilm ist.
Caroline Monnet: „Creatura Dada“, nun, es war der 100. Jahrestag des Dadaismus und ich wurde vom Festival du nouveau cinéma in Montreal gebeten, eine Carte Blanche zu erstellen, also ein sehr kurzes Video zu machen. Ich hatte den „Weiße-Seite-Komplex“, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also beschloss ich, das kleine Budget zu nehmen, das sie mir anboten, um Indigene Frauen an meinen Tisch einzuladen und ein Festmahl zu machen, Champagner zu kaufen und ihnen einen schönen Nachmittag zu bereiten. Und es ist sehr selten, dass wir die Chance bekommen, zusammenzukommen und uns einfach auszutauschen und miteinander zu reden und Zeit zu verbringen. Diese Frauen sind prominente Anführerinnen ihrer Gemeinschaft, sie sind Künstlerinnen, und du weißt, dass Nadia Myre dabei war, aber auch Alanis Obomsawin, die ein erstaunliches Vorbild für die Indigene Gemeinschaft ist. Ich habe die ganze Erfahrung gefilmt, es ging darum, alle Regeln zu brechen, weil sie uns in der kanadischen Gesellschaft nicht passen, und die Welt neu zu erfinden, wie wir es für richtig halten. Es ging darum, als Frauen vorwärts zu marschieren, als Anführerinnen unserer Gemeinschaften.
Sylvia Cunningham: Die Zuhörer*innen sollten sich das auf jeden Fall nach dem Interview ansehen, so wie du es beschreibst, ist es eine großartige Party und es gibt so viel Lachen und so viel Leben. Ich denke, gerade jetzt, wo Dinnerpartys im Grunde ein No-Go sind, hat es etwas besonders Faszinierendes, sich das anzusehen.
[O-Ton aus „Creatura Dada”]
Wir müssen dabei beachten, dass man den Originalton nicht hören kann. Es stellt sich also die Frage, worüber ihr alle gesprochen habt. Kannst du beschreiben, was das für ein Sound ist, was wir stattdessen hören und was dich dazu bewogen hat, den Originalton nicht einzubeziehen?
Caroline Monnet: Nun, es fühlte sich so an, als müssten wir das geheim halten. Wir können nicht alles preisgeben, weil wir eine Revolution planen. Wir können nicht jede*n davon wissen lassen, denn dann funktioniert der Plan nicht! Und jede*r wird davon wissen. Ich denke, es ist auch deshalb interessant, weil all dieses Essen in der Gastronomie als High-End-Essen gilt, aber das meiste davon ist sehr lokal, traditionelles Essen – Hummer, Austern. Ich habe diesen Film gemacht, nachdem es in den Medien ein großes Thema über Indigene Frauen gab, die von Polizisten in der Abitibi-Region missbraucht wurden, und dieser Film war eine Art Antwort darauf, dem negativen, viktimisierten Bild von Indigenen Menschen oder Frauen, besonders in den Medien, entgegenzuwirken. Frauen sind immer noch die am meisten marginalisierte Gruppe der kanadischen Gesellschaft. Das war die Absicht hinter dem Film.
Sylvia Cunningham: Ich bin kürzlich über dieses Zitat eines Musikers gestolpert, dass die „Pandemie keine Residency“ oder „Künstler-Retreat“ sei, als Antwort auf den äußeren oder vielleicht selbst auferlegten Druck, neue Arbeiten zu produzieren und super kreativ zu sein, wenn man sich abschottet. Wie ist es für dich gewesen?
Caroline Monnet: Ja, ich meine, es war eine gute Zeit, um ein bisschen langsamer zu machen, denn als Künstler*in ist man immer in der Phase des Produzierens und Präsentierens und Repräsentierens. Und sich die Zeit zu nehmen, nicht so viel zu reisen und mehr über die Recherche und die Vorbereitung auf das, was kommt, nachzudenken und die Arbeit, die man macht, neu auszurichten, das war gut. Ich habe an der Fertigstellung meines ersten Spielfilms gearbeitet, das war gut für mich, um mir mehr Zeit für die Postproduktion zu nehmen, anstatt es zu überstürzen und zum nächsten Projekt überzugehen. Ich schätze also, dass ich mir eine kleine Pause gegönnt habe und es nicht als eine Zeit des Schaffens angesehen habe. Es hat sich für mich nicht wirklich verlangsamt, ich musste anders arbeiten, würde ich sagen.
Sylvia Cunningham: Dieser Spielfilm, „Bootlegger“ – den du mitgeschrieben hast und der 2017 bei den Filmfestspielen in Cannes als bestes Drehbuch ausgezeichnet wurde – kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wo du damit stehst, worum es geht und wann wir ihn sehen können?
Caroline Monnet: Nun, der Film befindet sich in der Endphase der Postproduktion. Wir haben ihn im Dezember 2019 gedreht und sind gerade dabei ihn fertigzustellen, also können wir ihn hoffentlich etwas später in diesem Jahr veröffentlichen, vielleicht diesen Sommer oder Herbst. Aber das liegt wirklich nicht in meinen Händen, es ist die Produktionsfirma und der Rest der Leute, die das alles organisieren werden. Aber es ist natürlich aufregend, einen ersten Spielfilm zu machen, es ist ein bisschen nervenaufreibend, so ein Projekt in einer Zeit der Pandemie zu machen, weil wir nicht wissen, wie diese Filme enden werden – ob wir Leute in den Kinos haben werden, ob wir Filmfestival-Premieren haben werden, ob es online zu sehen sein wird? Und natürlich ist man ein bisschen enttäuscht, weil man fünf Jahre an einem Projekt arbeitet und es dann online erscheint und die Leute es auf ihren Bildschirmen sehen, aber es ist auch eine andere Erfahrung und vielleicht kann man auf diese Weise mehr Leute erreichen. Wir passen uns also an, und alles hat seine guten und schlechten Seiten.
Sylvia Cunningham: Die Musikerin Tanya Tagaq, die die Musik für „Mobilize“ geliefert hat, wird auch die Musik für „Bootlegger“ machen, richtig?
Caroline Monnet: Ja genau, es ist also eine fortlaufende Zusammenarbeit. Ich war sehr froh, dass Tanya Tagaq zugesagt hat, die Musik zu machen. Sie hat mit Jean Martin zusammengearbeitet, mit dem sie normalerweise auch zusammenarbeitet. Ich bin sehr zufrieden mit den Klängen, die sie zusammen geschaffen haben.
Sylvia Cunningham: Wie findest du, dass die Musik die Handlung und die Themen von „Bootlegger“ ergänzt?
Caroline Monnet: In „Bootlegger“ geht es um Selbstbestimmung und darum, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und sich von paternalistischen Gesetzen zu lösen. Also geht es in der Musik um die Verbindung zum Land, zum Territorium, um den Wunsch auszubrechen. Tanya Tagaq hat den perfekten Klang und die Energie für diese Dinge. Es ist diese Sehnsucht nach Selbstbestimmung, deshalb war ich sehr glücklich über die Verschmelzung meiner Bilder mit dieser Musik.
Sylvia Cunningham: Jetzt arbeitest du natürlich an mehreren Projekten gleichzeitig. Hast du das Gefühl, dass die Ideen, die du in einem Stück verarbeitest, irgendwie ihren Weg in ein anderes finden? Oder hältst du das getrennt?
Caroline Monnet: Ich plane nichts im Voraus, ich habe das Gefühl, dass jedes Projekt zum nächsten führt, und meine Praxis ist auch ziemlich instinktiv. Es geht darum, mit der Arbeit zu experimentieren, aber auch mit mir selbst, und ich hoffe, mich als Individuum weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass sich die Arbeit mit jedem Projekt weiterentwickelt. Aber auch mit verschiedenen Disziplinen zu arbeiten, hält mich auf Trab, hält mich engagiert und interessiert. Es hält mich auch außerhalb meiner Komfortzone, ich denke, dass ich dadurch als Künstlerin und Mensch wachsen und lernen kann. Da ich Soziologie studiert habe, hat jedes Projekt einen sozialen Hintergrund, egal ob es sich um eine visuelle oder skulpturale Arbeit oder um ein Video handelt. Dieser soziologische Hintergrund ist immer sehr präsent. Es geht darum, eine Erfahrung zu schaffen, eine emotionale Erfahrung mit so wenig Worten wie möglich. Es ist ein minimaler Ansatz, denke ich.
Sylvia Cunningham: Dieses Jahr wirst du deine erste Einzelausstellung im Montreal Museum of Fine Arts haben. Kannst du uns verraten, woran du dafür arbeitest?
Caroline Monnet: Ja, die Ausstellung wird den Titel „Ninga Mìnèh“ tragen. Das ist ein Wort aus dem Anishinaabemowin, das „Ich gebe es dir“ bedeutet und es ist das Wort, das wir für „Versprechen“ verwenden. Es befasst sich mit der Wohnsituation in Indigenen Gemeinden, die sich über die Jahre hinweg kaum verändert hat, in abgelegenen Regionen mit harten Wintern, Baumaterialien können knapp und sehr teuer sein. Und sie sind nicht sehr an die Umwelt dort im Norden angepasst. Es gibt eine Wohnungskrise, also wollte ich darüber sprechen und über den Mangel an Visionen seitens der kanadischen Regierung. Ich glaube, dass wir unsere Häuser bauen und dass unsere Häuser uns bauen. Wenn wir also billige Materialien verwenden und wenn es eine anhaltende Feuchtigkeit gibt, die Schimmel verursacht, dann wirkt sich das definitiv auf unsere mentale, physische und spirituelle Gesundheit aus. Deshalb denke ich, dass Häuser als lebende Körper behandelt werden sollten. Ja, und es geht einfach darum, einen Blick darauf zu werfen, wie das staatliche Wohnsystem die Armut in diesen Gemeinden verursacht hat und was wir tun können, um einen Dialog darüber zu eröffnen.
Sylvia Cunningham: Wenn wir unsere Häuser machen und unsere Häuser uns machen, wie denkst du, dass dein Haus dich macht und wie machst du es? Denkst du, dass du das persönlich darauf anwendest, wie du ein Haus baust?
Caroline Monnet: Ja, absolut. Ich lege sehr viel Wert auf meine Umgebung, ich glaube wirklich, dass wir die Umgebung um uns herum beeinflussen und die Umgebung uns beeinflusst. Wir stellen uns immer vor, dass die Menschen die Orte repräsentieren, an denen sie leben, aber im Fall der nördlichen Indigenen Gemeinden, bestimmter Indigener Gemeinden, glaube ich nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass es an Ressourcen fehlt, um ein richtiges Zuhause zu schaffen und diese Ausstellung will diese Vorurteile und negativen Stereotypen aufbrechen. Was mich betrifft, so ist es in meinem Studio im Moment ziemlich chaotisch, aber normalerweise ist es ziemlich organisiert und sauber. Jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt beginne, stelle ich sicher, dass ich aufräume, einfach um diesen geistigen Freiraum zu haben, um Dinge aufzuräumen. Ich mag kein Durcheinander aber so bin ich nun mal. Ich meine, andere Leute fühlen sich damit wohl. Ich persönlich brauche ein paar weiße Wände um mir andere Dinge vorstellen zu können.
Sylvia Cunningham: Caroline Monnet, multidisziplinäre Künstlerin, deren Werke „Mobilize“ und „Transatlantic“ in der Schirn zu sehen sind. Vielen Dank für deine Zeit.
Caroline Monnet: Oh, es war mir ein Vergnügen.
SCHIRN Podcasts kostenlos abonnieren und auf dem Handy oder Tablet herunterladen.
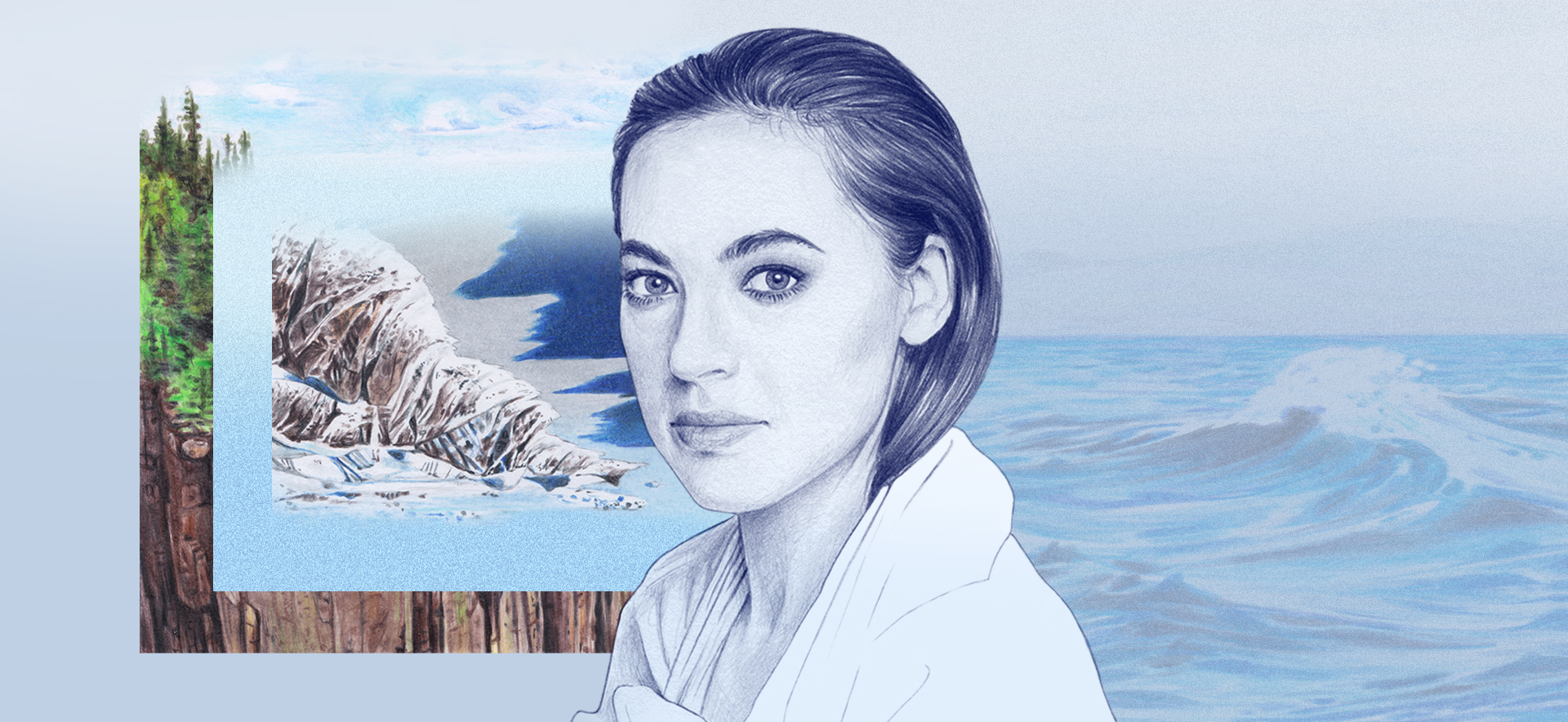
Das könnte Sie auch interessieren
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt.








