Zwei neu erschienene Bücher der in London und Wales lebenden Mutter, Aktivist*in und „Amateurschriftsteller*in“ Suzanna Slack – „Is This It?“ (2020) und „The Poor Children“ (2021) – kommen beide als „ein Erinnerungsprojekt“ daher. Alle beide sind mit eigenen Fotografien der Autor*in illustriert, sind fragmentarische Erinnerungen an das Leben auf dem Land und in der Stadt und blenden über zwischen Kindheit, Mutterschaft, Liebe und Politik.
Darin eingestreut finden sich Reflexionen zu Zitaten und Gedanken von Schriftsteller*innen, von Balzac bis Jacques Derrida, von Jacqueline Rose bis Carolyn Steedman, von Toni Morrison bis zu der aufstrebenden Dichterin Warsan Shire: Die Epigrafe für „The Poor Children“, die ich hier aufgreifen möchte, laden dazu ein, die Neutralität einer Erzählperspektive zu hinterfragen, die „den bürgerlichen Haushalt, in dem Türen entlang des Flurs aussperren“, in den Mittelpunkt stellt. Sie laden ein, darüber nachzudenken, wie gesellschaftliche „Urteile“ dazu geführt haben, dass bestimmte Subjekte – in dem Fall LGBTQIA+ Menschen, Mittellose und Frauen, insbesondere Mütter – weitgehend aus der Literatur ausgeschlossen blieben und dass (wie Derrida es ausdrückte) „jedes Buch eine Pädagogik beinhaltet, die darauf abzielt, die Leser*innen zu formen“.
Die explizite Verortung memoirenähnlichen Materials innerhalb eines weiter gefassten politischen, kulturellen und intellektuellen Rahmens wird all jenen vertraut sein, die im letzten Jahrzehnt Autor*innen wie Chris Kraus, Paul Preciado oder Kate Zambreno verfolgt haben. Doch verweigert sich Slack jeder Linearität, versucht einen Stil zu begründen, der zwischen der romanhaften Technik des Bewusstseinstroms und einer Aneinanderreihung von Aphorismen angesiedelt ist.
[J]edes Buch beinhaltet eine Pädagogik, der es darum geht, die Leser*innen zu formen

Suzanna Slack, The Poor Children, 2021, Courtesy Suzanna Slack, Image via goodpress.co.uk
In „The Poor Children“ (Die armen Kinder) macht sich Slack Gedanken über den populären englischen Ausdruck „losing the plot“ (den Überblick verlieren). Meist wird er in Zusammenhängen verwendet, in denen jemand außerstande ist, erwartungsgemäß zu funktionieren, doch im eigentlichen Wortsinn bedeutet er: „jedes Gefühl für den Erzählzusammenhang verloren zu haben, ein Wegfallen der Geschichte unseres Lebens“. „Losing the plot“ ist für Slack die Konsequenz „mehrerer Schocks“, wie etwa die Enthüllung lang gehüteter Familiengeheimnisse oder mitzuerleben, wie der Bruder als Kind von den Eltern geschlagen wurde, und „allzu häufig Vergewaltigungen“.
Diese „Schocks“ verbindet Slack mit der Schwierigkeit, über ihre Ursachen oder Nachwirkungen zu schreiben. Ein „tiefer Schock kann es erforderlich machen, dass wir ganz neu verdrahtet werden“, schreibt Slack, doch das hierfür notwendige „systematische Regime verschiedener Werkzeuge, therapeutischer Maßnahmen und Verfahren“ ist vielleicht ja nicht allen zugänglich. Viele Menschen leiden so sehr unter einem Schock oder einer PTBS, dass sie noch nicht einmal diese Notwendigkeit erkennen können. Hier geht es Slack – im Sinne von Derridas pädagogischem Imperativ – darum, die Leser*innen zu formen. Slack versucht, die Art und Weise zu vermitteln, in der sich der Schock selbst als wiederkehrende Erinnerungen an ein Trauma (innerhalb der Familie etwa oder in Beziehungen) manifestiert, indem sie dies formal einbezieht, sich einer Folge kurzer Vignetten mit unterschiedlichen und einzigartigen Titeln bedient, die aber stets auf dieselben Themen, Anekdoten und kulturellen Bezüge zurückverweisen.
Ein tiefer Schock kann es erforderlich machen, dass wir ganz neu verdrahtet werden
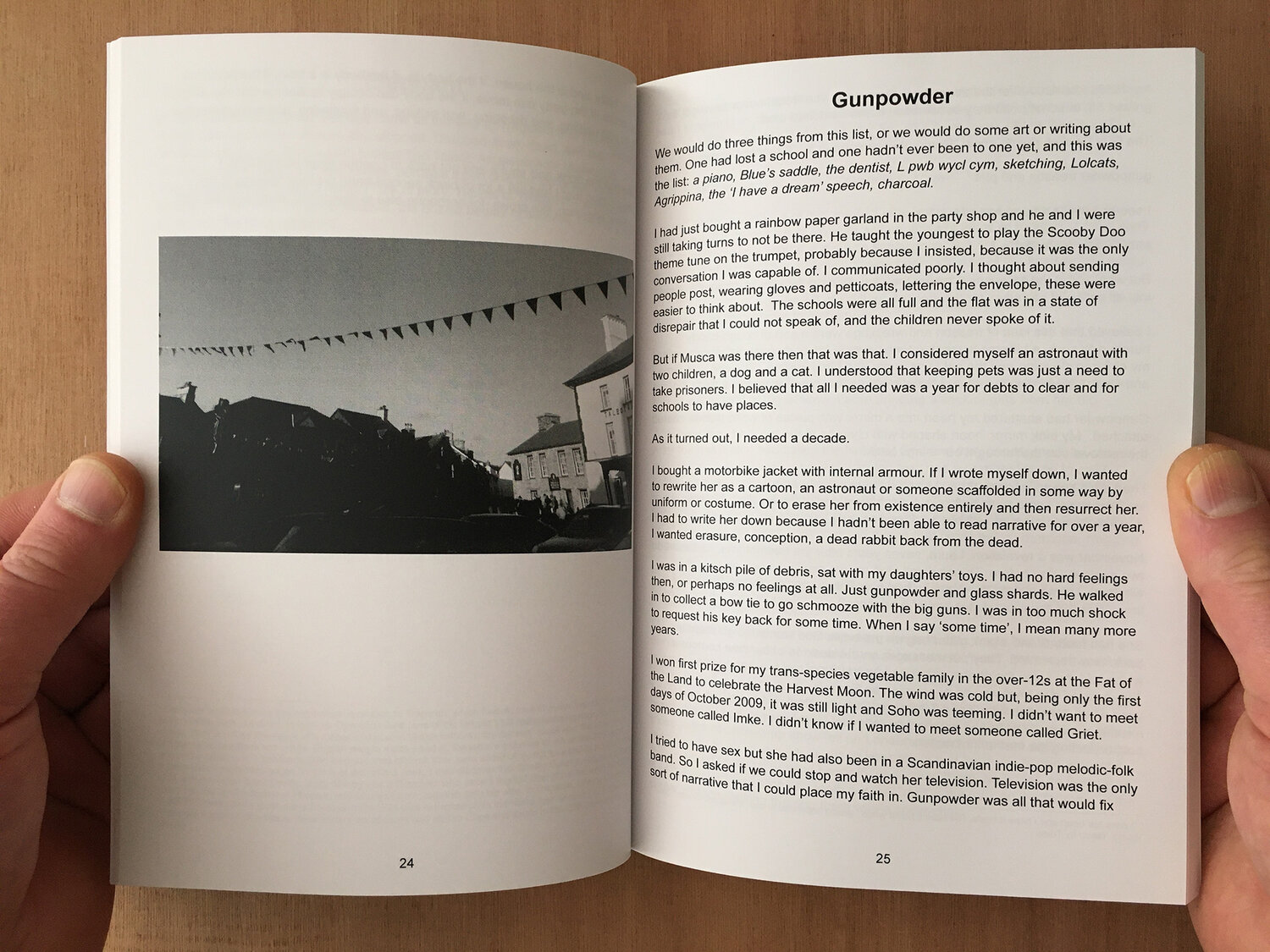
Suzanna Slack, The Poor Children, 2021, Courtesy Suzanna Slack, Image via goodpress.co.uk

Suzanna Slack, Is This It?, 2020, Courtesy Suzanna Slack, Image via vfpress.wixsite.com
Damit bewegt sich „The Poor Children“ irgendwo zwischen Memoiren und politischem Kommentar: Slack misstraut jedem Genre, vor allem aber der „Autofiktion“ und zitiert hierfür in einer Fußnote die afroamerikanische Autorin Toni Cade Bambara zu den Auswirkungen, die das Publizieren halb autobiografischer Romane auf die Beziehungen von Schriftsteller*innen zu Geliebten, Freundeskreis und Familienangehörigen hat. Sowohl „Is This It?“ als auch „The Poor Children“ besteht aus kurzen Vignetten, die sich einer einfachen Einordnung entziehen. Am erfolgreichsten ist diese Herangehensweise in einem Abschnitt von „The Poor Children“ mit dem Titel „Routes“ (Leitwege): Er wechselt zwischen Nachdenken über den Druck, eine alleinerziehende Mutter zu sein (eine der am stärksten dämonisierten Gruppen in Großbritannien), und den Begriff der Kernfamilie, bezieht neben Morrison, Rose und Rachel Cusk auch verschiedene religiöse Praktiken in den Text mit ein.
Für die Leser*innen entsteht so der fesselnde Eindruck, dass Slack mit und gegen diese Autor*innen denkt. Der Plauderton schafft echte Intimität – man kann sich leicht vorstellen, diesen Erinnerungen am Küchentisch oder im Wohnzimmer zuzuhören, wobei mehrere Vignetten (wie etwa „Routes“) darüber reflektieren, was „Mutterschaft“ bedeutet, ohne aber den Begriff jemals über ein Gefühl der Liebe und Achtung für die eigenen Kinder hinaus festzuschreiben. Eine der größten Stärken dieses Stils liegt jedoch darin, dass er Slack erlaubt, unmittelbar, fast ohne dass die Leser*innen es bemerken, von Detailbeobachtungen alltäglicher Begebenheiten hin zu weitreichenden philosophischen oder politischen Einsichten überzugehen.
Besonders wirkungsvoll gelingt es „The Poor Children“, die Textur Londons in den frühen 2010er-Jahren einzufangen. Damals war die britische konservativ-liberaldemokratische Koalition eine von vielen in Europa, die im Anschluss an die Finanzkrise 2008 umfassende Einschnitte bei Sozialleistungen und öffentlichen Diensten vornahm. (In Großbritannien fielen sie besonders rücksichtslos aus: 2019 machte das Institute for Public Policy Research diese Politik für 130 000 zusätzliche Todesfälle seit dem Jahr 2012 verantwortlich.) Slack fängt die Wut bei Demonstrationen gegen Studiengebühren 2010 ein, verweist auf die Ausnutzung des „progressiven Patriotismus“ rund um das diamantene Thronjubiläum der Queen und die Olympischen Spiele 2012 durch die Regierung, vor allem aber werden Auswirkungen der Austerität über das Persönliche erkundet.

Suzanna Slack, The Poor Children, 2021, Courtesy Suzanna Slack, Image via goodpress.co.uk
Slack sorgt sich unablässig darum, wie er*sie als Single-Mutter zwei Kinder ernähren soll, aber auch um die Komplikationen der Mutterschaft für eine Person, die sich, wenn auch umständlich, als „queer“ identifiziert, und erträgt langsame, frustrierende Interaktionen mit einem Gesundheitssystem, das zunehmend unter Druck gerät – dabei liegt der Fokus stets auf dem Überleben und wie man davon erzählt. Indem die „Handlung“ bis zur Covid-19-Pandemie weitergeführt wird, hofft Slacks Erzähler*in, dem zwanghaften Erinnern ein Ende zu setzen. Es würde eine Erholung von dem Schock signalisieren, der „The Poor Children“ zugrunde liegt. Die „Erinnerungsarbeit“ vollzieht sich als ein „Selbst-Stalking“. Ein Vorgang, der erleichtert wird durch den Übergang von der „Internet-Zeit“, als das Digitale noch eine untergeordnete Rolle in einem überwiegend offline geführten Leben zu spielen schien, hin zur „Internet-Sättigungs-Zeit“ der 2010er Jahre. Damals wurde es möglich, jede Bewegung zu veröffentlichen und zu archivieren, das Online- begann sich untrennbar mit dem Offline-Leben zu verbinden.
Die Ehrlichkeit in Bezug auf die psychologische Wirkung einer solch „unerbittlichen“ Freilegung des Selbst und Slacks Offenheit während dieses „Erinnerungsprojekts“ machen „The Poor Children“ zu einem Werk der Katharsis nicht nur für die Autor*in, sondern auch für die Leser*innen – wir sind eingeladen, unsere eigene „Erinnerungsarbeit“ zu leisten, und bekommen einen literarischen Stil angeboten, der als Rahmen dienen kann. Wir können Slacks Überlegungen aber auch einfach auf uns wirken lassen, der Aufforderung folgen, darüber nachzudenken, wie etwa Begriffe wie „Mutterschaft“ und „Queerness“ einander verkomplizieren, und Slacks Werk nicht als Diktat, sondern als Einladung zum Dialog oder zumindest zum eigenen Nachdenken begreifen.