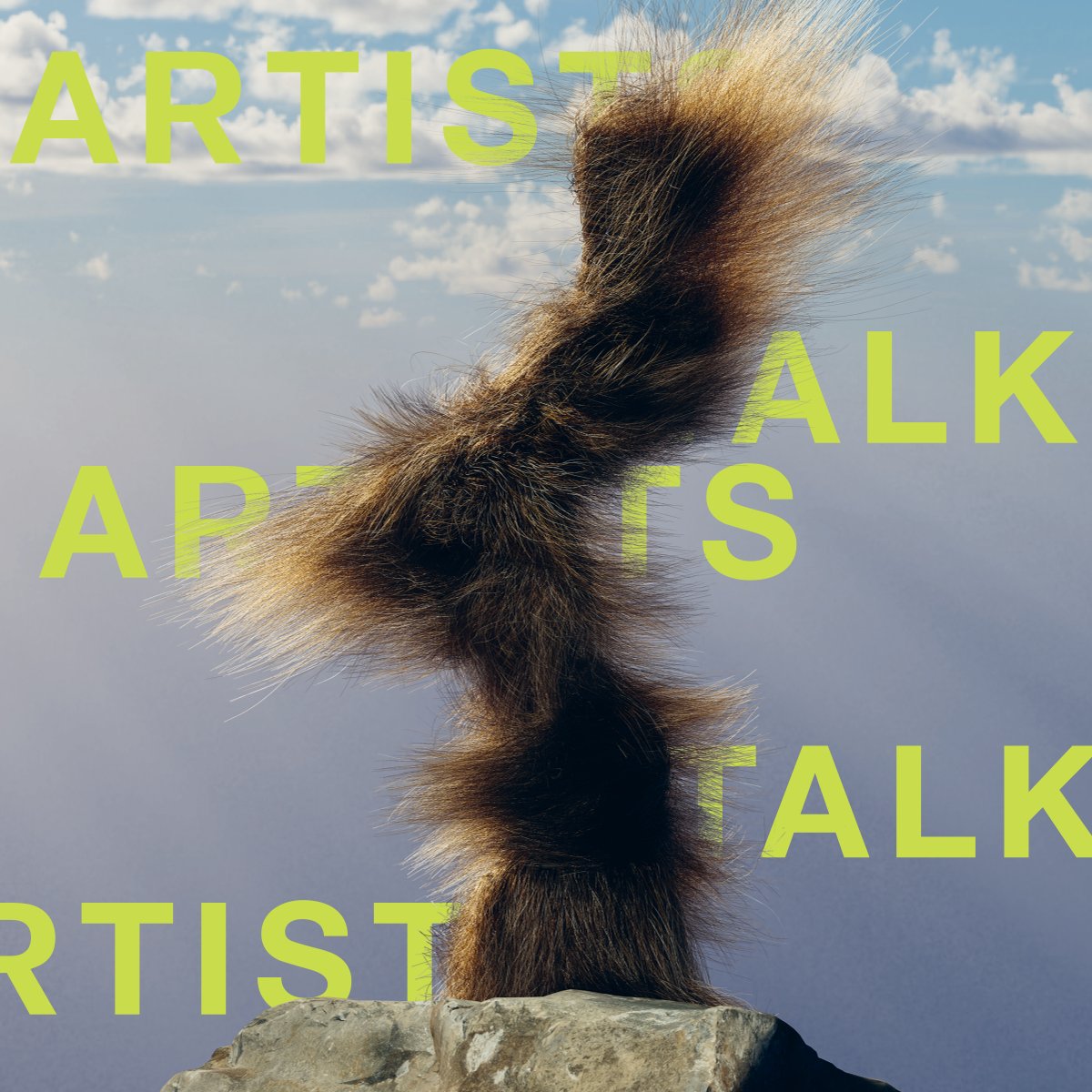5 Fragen an Annette Urban
07.04.2025
10 min Lesezeit
Anlässlich der Ausstellung „Troika. Buenavista“ lädt die SCHIRN am 8. April zum Expert*innengespräch über die Schnittstellen von virtuellen und realen Bildwelten ein. Prof. Annette Urban forscht zu medialen Ortsbezügen und vernetzten sowie virtuellen Lebenswelten – wir haben ihr vorab 5 Fragen gestellt.
1.
Angefangen bei Virtual-Reality-Brillen über KI-Chatbots bis hin zu Gamification und KI-Einbindungen für militärische Zwecke: Das Virtuelle verschränkt sich zusehends mit dem Weltgeschehen. In welchem Bereich würden Sie die Verschmelzung virtueller und realer Lebenswelten als besonders positiv oder produktiv bewerten und in welchem als problematisch?
Annette Urban
In dem Bochumer Sonderforschungsbereich „Virtuelle Lebenswelten“, in dem ich derzeit mit Kolleg*innen aus Medien-, Literatur- und Erziehungswissenschaft u.a. tätig bin, versuchen wir, die Verschränkungen mit jenem Virtuellen zu fokussieren, das heute nicht mehr vorrangig spektakulär, sondern längst normal geworden ist. Damit stellen wir die großen Zukunftsversprechen und Dystopien erst einmal hintan. Und es geraten nicht nur das große Weltgeschehen, sondern vor allem die nahe Lebenswelt und unsere alltäglichen, körperlich vermittelten Weltbezüge in den Blick. Dennoch entlässt uns das nicht aus der Verantwortung, diese Entwicklung hin zu einem hybriden, zugleich virtuell wie physisch Realen kritisch zu begleiten und an alternativen Gestaltungsoptionen, nicht zuletzt von Seiten der Kunst, zu arbeiten. Denn Verlebensweltlichung von Technologie heißt umgekehrt nach dem Philosophen Hans Blumenberg auch, dass diese zur unhinterfragten Selbstverständlichkeit geworden ist, welche es erst wieder aufzubrechen, zu verfremden und damit befragbar zu machen gilt.
Betrachtet man beispielhafte Anwendungsbereiche, fallen insbesondere die steten Ambivalenzen auf: KI führt nicht nur durch Racial Profiling (verdachtsunabhängige Polizeikontrollen von Personen u.a. aufgrund ihrer Hautfarbe) etwa großes Unrecht herbei, sondern kann auch die Auswertung immenser Datenmengen von kinderpornografischem Material unterstützen, die die menschlichen Personalressourcen überfordert. Mit Virtual Reality geht nicht allein jener Eskapismus einher, den wir oft ebenfalls mit Computerspielen assoziieren und der mit dem jüngsten Hype um durchlässige Mixed-Reality-Headsets ein ganzes Metaverse von Unterhaltungs- und Shoppingangeboten ins heimische Wohnzimmer zu holen verspricht. Umgekehrt entpuppt sich VR als ein Hilfsmittel, das z.B. bei der Gestaltung eines demenzsensiblen Lebensumfeldes nützlich sein kann. Oder sie begegnet uns als ein zweischneidiges Well-Being-Tool, dem gerade auf Basis von Naturdarstellungen, wie sie auch Troika interessieren, ebenso heilsame Wirkung wie zusätzlicher Selbstoptimierungsdruck zu eigen ist.

2.
Troikas „Buenavista“ zeigt einen Kuka-Roboter in einer stetig wechselnden Umgebung, die auf digitalisierten und digitalen Landschaftsdarstellungen sowie Elementen (Assets) aus Videospielen basiert. Was interessiert Sie an dieser Videoarbeit?
annette urban
Faszinierend erscheint mir an dieser panoramaartigen Videoprojektion zuerst einmal ihr schon aus anderen Werken bekannter Protagonist. Durch seine wesensgleiche, nur aus wirbelndem Haar bestehende Gestalt ist er als Roboter beinahe unkenntlich und tritt hier in enge Wechselbeziehung zum umgebenden Bilderreigen voller Landschaftsimaginationen. Troika treibt dabei ein vieldeutiges Spiel, indem der sonst auf Produktionsabläufe trainierte Industrieroboter mit Bewegungsdaten ritueller Tänze gespeist wird. Ausgerechnet ein Arbeitsarm wird so mithilfe algorithmischer Steuerung zur spirituellen Ekstase und Vereinigung mit der Natur animiert, die eigentlich menschlicher Sehnsucht nach Heraustreten aus dem begrenzenden Körper entspringt. Eine solche Symbiose jedoch liefert die schöne Landschaft von „Buena Vista“, die ihre Kulisse ständig wechselt und dabei diverse Versatzstücke einer cleanen Computerspiel-Natur synthetisiert, nur bedingt. In der Animation verzichtet Troika auf jene Perfektion, mit der sich computergenerierte Umgebungen sonst aus diversen Assets zu einer überaus konsistenten, interaktiven Welt zusammenfügen. So verhält sich das bewegte Haar z.B. teils nicht mit den Umwelteinflüssen im Bild konform. Dennoch entsteht mitunter ein Zusammenklang zwischen rhythmisch wechselnden Vegetationen und dem musikalisch untermalten Kreisen des solitären Roboters, der uns Zuschauer*innen nahezu körperlich in den Bann zieht.
Insofern leiten uns solche künstlerischen Arbeiten nicht primär zur Dechiffrierung von virtuellen und realen Elementen an, auch wenn in vielen Lebensbereichen heute eine solche Unterscheidungsfähigkeit und ein medienkompetenter Umgang mit KI-Bildern von größter Wichtigkeit sind. Vielmehr werden wir in der Ausstellung auf die Spur dessen gesetzt, was künstliche Intelligenz alles implizieren kann, die nicht nur Daten viel schneller verarbeitet und selbständig lernt, sondern die ebenso Bewegungen von menschlichen auf künstliche Wesen zu übertragen erlaubt. Wenn diese schließlich einen eigenen Einklang mit ihrer Umwelt zu imaginieren beginnen – das suggerieren zumindest die endlosen Landschaftstransformationen, die an autonom prozessierende Bildgeneratoren erinnern – dann bleiben menschliche Betrachter*innen in gebannter Stasis zurück.
3.
Kunstwerke wie Troikas „Irma Watched over by Machines“ oder „Ultra Red, Evergreen, Ocean Blue“ machen die für digitale Bilder typische Farbfilteranordnung in Rot, Grün und Blau visuell erlebbar. Welche Rolle kann Kunst in unserem Umgang mit neuen Technologien spielen und welche nicht?
annette urban
Gerade das Beispiel der Farbfilter, die Troika für „Ultra Red, Evergreen, Ocean Blue“ an verschiedenen Ausstellungsorten als Folie auf den Fensterscheiben einsetzen, verdeutlicht sehr gut das Potenzial von Kunst in dieser Hinsicht: Denn sie besitzt eine große Fähigkeit zur Abstraktion in einem ganz klassischen, aus der Malerei geläufigen Sinn und vollzieht damit zugleich eine Ästhetisierung, die einen Übergang in unsere gebaute und atmosphärisch erfahrene Lebenswelt ebnen kann. Dies birgt eine nicht gering zu schätzende Möglichkeit, um den oft nicht so einfachen Zugang zu Kunst, die sich mit unserer digitalen Gegenwart befasst, zu erleichtern.
So vermag eine grundlegende Verfremdung des Gewohnten, wie sie etwa in den von Troika stark monochrom gefärbten Ausstellungsräumen auftritt, unser Bewusstsein für die Relativität der technisierten ebenso wie der vermeintlich ‚natürlichen‘, vom Menschen her gedachten Wahrnehmungsweisen von Welt zu schärfen. Die drei Farben Rot, Grün und Blau nehmen auf den sogenannten RGB-Farbraum als Prinzip additiver Farbmischung durch Licht sowie auf den Bayer-Filter Bezug, der digitalen Fotosensoren das Farbsehen überhaupt erst ermöglicht. Das dabei dominante, teils giftige Grün, das auch „Irma Watched over by Machines“ – Troikas pixelartige Gemäldeserie auf Basis digitaler Überwachungsbilder vom Hurrikan Irma – prägt, entspricht wiederum der überproportionalen Relevanz dieses Farbtons für das menschliche Auge, dessen Helligkeits- und Schärfewahrnehmung maßgeblich vom Grünanteil im Grau gesteuert wird. In anderen Arbeiten, wie etwa beim Höhepunkt des Videos „Terminal Beach“, kehrt Troika mit Rot- und Pinktönen das von Photosynthese treibenden Pflanzen absorbierte Wellen-Spektrum und somit ihr spezifisches „Sehen“ hervor.
Nicht umsonst hat sich der Fokus allgemein weg vom lange privilegierten Visuellen hin auf sogenannte sensing media verlagert, denen, wie u.a. der gleichnamige Potsdamer Forschungsverbund gezeigt hat, eine eigene Sensibilität und Wissensproduktion zuerkannt werden muss. Dies berührt sich mit der Technizität von Sensormedien, die in den meisten digitalen Geräten verbaut und oft erst mal bildlos sind. Zugleich ist damit auf das breite sensorische Spektrum verwiesen, über das sowohl technische wie tierisch-pflanzliche und menschliche Systeme verfügen und das unter ihnen Fremdheits-, aber auch Verwandtschaftserfahrungen stiften kann. Genau hier setzen Künstler*innen an.


4.
Inwiefern verändert unsere digitale Realität die Arbeitsweise von Künstler*innen wie Troika? Gibt es künstlerische Praktiken, die als symptomatisch für Kunst an der Schnittstelle von digitalen Technologien, gelten kann?
annette urban
Das Beispiel von Troika ist sprechend dafür, in welcher Weise sich die künstlerische Auseinandersetzung mit neuen Technologien über deren direkte Anwendung hinaus mit anderen Praxen künstlerischer und nicht künstlerischer Provenienz verbinden kann. In den Ausstellungen wie jüngst in Frankfurt oder Neuss finden wir ebenso klassische Kunstgattungen wie Malerei und Skulptur, die wiederum Affinitäten zum Digitalen offenbaren, sei es in der schon erwähnten Gemäldeserie „Irma Watched Over by Machines“ durch mathematische Rasterisierung und numerische Zerlegung von Farbwerten oder bei der Skulpturenserie „Compression Loss“ durch den 3-Druck, der eine menschlich-tierische Hybridisierung von inzwischen digitalisiert vorliegenden Meisterwerken historischer Bildhauerkunst ermöglicht.
Sehr typisch ist zudem die starke Verzahnung mit Recherchepraktiken, die Troika am Gegenstand der Natur in Technik-, Wissens- und Menschheitsgeschichte eintauchen lassen, um diese entlang von Salz/Silizium z.B. vom Feuerstein zum Mikrochip neu zu erzählen und nicht selten mit technikeuphorischen oder dystopischen Science-Fiction-Narrativen zu unterfüttern. Hierin macht sich die Tendenz zum Fictioning geltend, die auch in der Bildenden Kunst zu beobachten ist: Wiederkehrende Protagonist*innen werden dabei mit einer ganzen Welt in all ihrer Tiefe, d.h. inklusive ihrer Mythen, ihrer jeweiligen Vergangenheit und Zukunft, ausgestattet. Hierin äußert sich jenes Worldbuilding, welches aus angestammten Bereichen wie dem Computerspiel inzwischen in die Gegenwartskunst eingewandert ist. Das kann wie bei Troika im genuin künstlerischen Medium der Ausstellung geschehen, die auf ihre Weise ein Ambiente und eine künstliche Umwelt als zweite Natur (in der Philosophie bezeichnet dies eine vom Menschen selbst geschaffene, hier aber schon posthumane Sphäre) evoziert. Ebenso wichtig sind künstlerische Herangehensweisen, die virtuelle Welten direkt im Umgang mit 3D-Design und auf entsprechenden Plattformen entwerfen. Symptomatisch ist also die Vielfalt.

5.
Kunst übt sich gerne in utopischen oder dystopischen Zukunftsvisionen. Gibt es ein künstlerisches Zukunftsszenario (gut oder schlecht), das Ihnen besonders realistisch erscheint?
annette urban
Wie oben angedeutet, scheint mir mit Blick auf die Verschränkungen von virtuellen und ‚realen‘ Räumen gar nicht allein die Zukunft interessant, sondern die Gegenwart für sich schon reichhaltig. Gleichzeitig richtet sich an Kunst die Erwartung der Visionierung und entwerferischen Gestaltungsfreiheit, was sich bei KI mit deren Fähigkeit der Datenmodellierung zur Vorhersage künftiger Szenarien berührt. In der genannten Gemäldeserie von Troika oder auch ihrem Video „Terminal Beach“ zeigt sich das maschinelle Sehen betont gleichgültig gegenüber den vom menschengemachten Klimawandel begünstigten Naturkatastrophen oder dem Fall des letzten Baumes durch die Axt des Roboterwesens. In den eben kurz erwähnten Arbeiten schließt das Künstler*innentrio anhand von Salz/Silizium die Gegenwart mit einer Jahrtausende bzw. Jahrmillionen entfernten Vergangenheit kurz. Dezentriert wird so ein immer noch vorherrschender Anthropozentrismus, dem Troika andere Intelligenzen, diejenige der Disteln als resistente Arten wie in „Anima Atman“ oder, wie Eva Wilson in ihrem Text zum Buch „Untertage“ betont hat, diejenige des Anorganischen entgegenstellt, welche bis in eine Welt jenseits des Menschen hineinreichen. An Prognosen über die Wahrscheinlichkeit kommender Technologie-Szenarien kann ich mich kaum beteiligen.
Aus kunstwissenschaftlicher Sicht ist es in der Spanne der letzten 30 Jahre schon lehrreich, wie Medienkünstler*innen wie Lynn Hershman Leeson etwa Zukünftigkeit anhand der Verführung eines weiblichen Cyborgs imaginiert haben. In der Gegenwart hat Yael Bartana z.B. im Deutschen Pavillon in Venedig allein mit Lichteffekten eines Rotors, einem Film und einer Kuppelprojektion eine Vision vom Verlassen dieser Erde zugunsten einer zweiten künstlichen im All geschaffen, deren Bewohner*innen wir u.a. als KI-Gesichtern begegnet sind. Aktuell scheinen die oft verflochtenen Technikutopien und -dystopien gerade bei KI letzteren zuzuneigen. Selten findet sich der algorithmisch gesteuerte Roboterarm, der bei Troika einen Wendepunkt zur posthumanen Welt markiert, in derart kokreativer Partnerschaft aufgehoben wie etwa in den Zeichnungsperformances von Sougwen Chung. Nichtsdestotrotz gibt es künstlerische Projekte, die die digitale Gegenwart mit Visionen eines besseren Lebens verbinden. Häufig werden dafür die dominanten Technologien den immer rigideren Voreinstellungen der Tech-Konzerne zum Trotz nach Möglichkeit umgenutzt und den Bedarfen bestimmter Communities angepasst.


Weiterlesen auf dem SCHIRN MAG
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt.