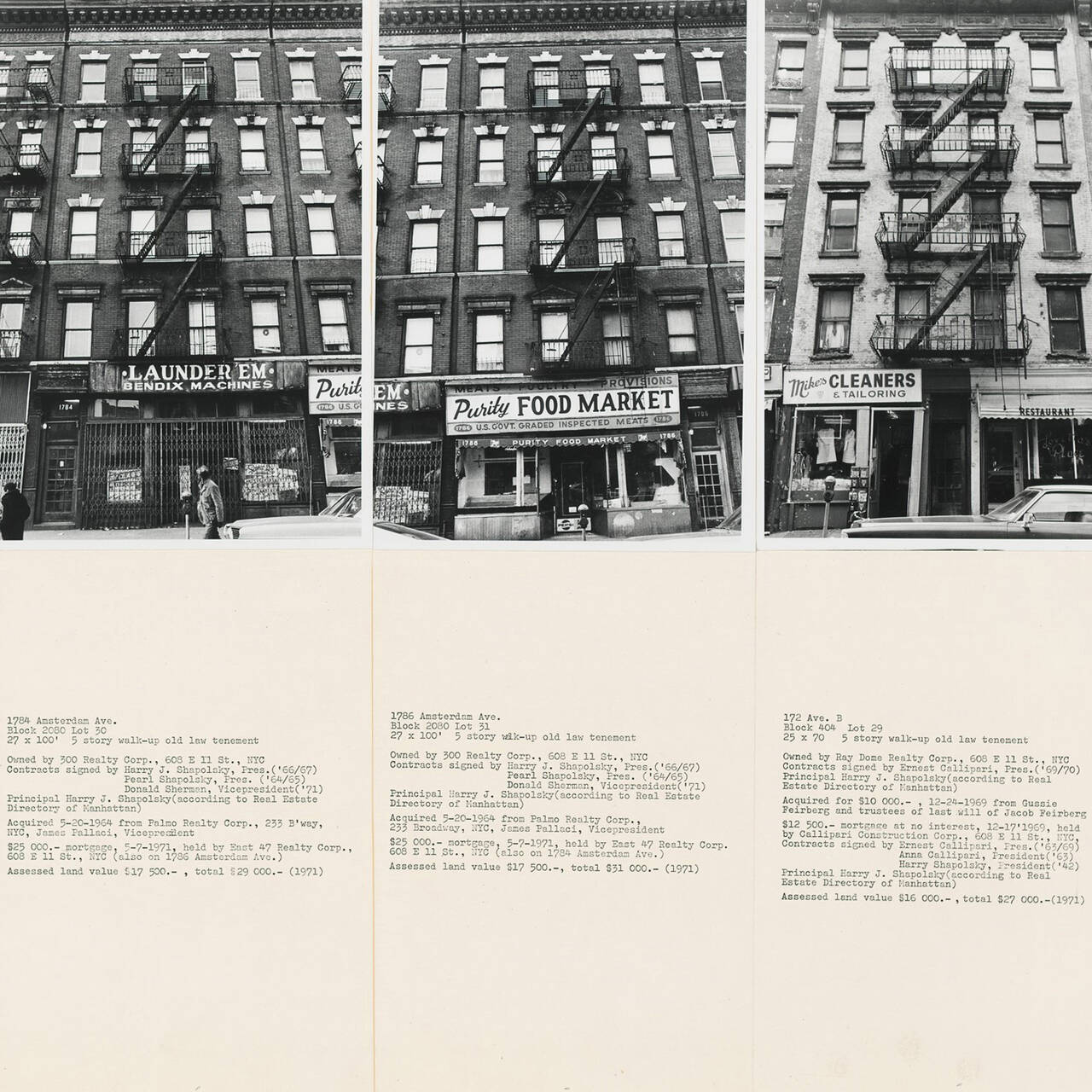Sind Künstler*innen besonders kreativ, wenn es ums Kochen geht? Ein Blick in die Küchen der Kunstwelt. Diesmal geht es um Festessen der etwas anderen Art – ganz ohne Gänsebraten.
Wer nicht zur Würstchen-mit-Kartoffelsalat-Fraktion gehört, der schmort zu Weihnachten häufig ein Stück Fleisch oder ein vegetarisches Pendant, oft begleitet von Rotkohl und Klößen. An Silvester dominiert Käse in mehr oder weniger geschmolzener Form, und wenn jemand Geburtstag hat, dann gehört ein Kuchen auf den Tisch. Beim Kochen für einen festlichen Anlass geht es wohl bei den wenigsten wirklich kreativ zu – aber gilt das auch für Künstler*innen? Schließlich liegt es in der Natur dieser Berufsgruppe, Konventionen zu brechen. Wir erlauben uns ein kleines Gedankenspiel: Was gäbe es wohl zu essen, wenn wir an einem Festtag bei Marina Abramović, Sophie Calle oder Gilbert & George vorbeischauen würden? Was hätte Tracey Emin für uns vorbereitet, und welches Menü würde wohl Carsten Höller servieren?
Bitte setzt euch, der Tisch ist gedeckt!
Marina Abramović
Wir starten unseren festlich-gastronomischen Etappenlauf mit starkem Hungergefühl, denn die Gastgeberin hat in ihrer Einladung klargestellt, dass wir vor dem Dinner fünf Tage lang fasten müssen. Als wir in ihrem Loft in Manhattan ankommen, liegt auf einer langen Tafel im Esszimmer ein Haufen aus rohem Reis und Linsen. Es heißt, dass wir die Zutaten fein säuberlich trennen und abzählen sollen, bevor es etwas zu essen gibt. Unser Geduldsfaden reißt mehrmals und wir sind kurz davor aufzugeben, aber wer möchte sich schon vor der Königin der Performance-Kunst blamieren? Als die Zählerei endlich geschafft ist, verbindet Abramović uns die Augen und serviert eine Schale gekochten weißen Reis. Der erste Bissen schmeckt nach der langen Abstinenz so unglaublich köstlich, dass wir in eine Art Trancezustand verfallen und die bisherigen Strapazen augenblicklich vergessen. Zum Nachtisch gibt es die einzige Speise, der auch Abramovićs eiserner Willen nicht widerstehen kann: weiße Schokolade. Während wir uns die süßen Stückchen auf der Zunge zergehen lassen, schaut uns die Künstlerin tief in die Augen – so lange, bis wir zu Tränen gerührt sind. Oder kommt das vielleicht von der rohen Zwiebel, die es als Beilage gab?

Tracey Emin
Weiter geht es an den britischen Küstenort Margate, der Heimatstadt von Tracey Emin. Kaum haben wir die Jacke abgelegt, führt sie uns in ihr Schlafzimmer. Gegessen wird heute selbstverständlich im Bett. Während wir versuchen, zwischen zerwühlten Laken und benutzten Papiertaschentüchern eine gemütliche Position zu finden, kommt die Gastgeberin mit einem Tablett hereinspaziert, das mit Kaviar und Austern beladen ist. Sofort stellt sich ein festliches Gefühl ein, auch wenn die leeren Wodkaflaschen auf dem Schlafzimmerteppich die Idylle etwas brechen. Ein Relikt aus alten Zeiten, versichert uns die Künstlerin, die mittlerweile weder raucht noch trinkt. Demonstrativ serviert sie zu den Meeresfrüchten (sehr zu unserem Leid) nicht etwa Champagner, sondern japanischen grünen Tee. Auch gut, denken wir, zumindest ist es nicht ein halber Liter Nesquik mit Erdbeergeschmack – ihr einstiges Getränk der Wahl vor einer langen Partynacht. Emin verschwindet kurz und kommt mit dem Hauptgang wieder: selbstgekochte Hühnersuppe, aromatisiert mit Kräutern aus dem Gemüsegarten ihrer Villa in Südfrankreich. Wir löffeln die Suppe aus, lassen uns auf das Kopfkissen sinken und schlafen, satt und selig, augenblicklich ein.

Gilbert & George
Knapp zwei Stunden Autofahrt dauert es bis nach London und weiter in die Fournier Street, wo Gilbert Prousch und George Passmore auf uns warten. Nach einer kurzen Tour durch die Wohnung wird uns klar, dass die beiden nicht vorhaben, uns mit ihrer Kochkunst zu beeindrucken: In keinem der Räume ist eine Küche zu finden. Dass die beiden den Geruch von warmem Essen hassen, ist bekannt, aber zumindest ein paar kalte Platten hätten sie doch vorbereiten können? Aus Reflex beginnt unser Magen zu knurren, und als die Gentlemen uns einen Gin Tonic anbieten, ahnen wir Böses. Uns so elegant zu betrinken wie Gilbert & George schaffen wir bestimmt nicht, also lassen wir es lieber ganz sein. Während wir überlegen, einen Toilettengang zu simulieren, um möglichst unauffällig an die Cracker in unserer Jackentasche zu kommen, steht George auf und kündigt an, dass es höchste Zeit sei, aufzubrechen, um pünktlich um acht an ihrem Stammtisch im „Mangal II” zu sitzen. Erleichtert folgen wir seiner Aufforderung und machen uns auf in Richtung des türkischen Restaurants, wo das Künstlerpaar wie jeden Abend eine Vorspeise und eine halbe Hauptspeise bestellen wird. Auch wenn diese Routine auf den ersten Blick nicht besonders festlich erscheint – die beiden feiern sie offensichtlich sehr.

Sophie Calle
Malakoff, ein Vorort von Paris. Sophie Calle öffnet die Tür zu ihrem Studio-Loft, ganz in schwarz gekleidet, mit dunkler Sonnenbrille im Gesicht und einem Glas Champagner in der Hand. Im Hintergrund ertönt Jazzmusik, der Tisch ist festlich gedeckt. Wir überreichen unser Gastgeschenk – einen Gutschein für eine Stunde mit einer renommierten Wahrsagerin – und nehmen Platz. Diesmal sind wir nicht allein, denn Calle hat auch ihre Freund*innen und ihre Familie eingeladen. Dominique, Florence, Rafael, Monique – sie alle hängen in Form von ausgestopften Tieren an den Wänden und stellen sich als wenig gesprächig heraus. Als Calle damit beginnt, das Abendessen aufzutischen, sehen wir rot. Nicht, weil wir die Speisen verschmähen, sondern weil das komplette Menü monochrom gehalten ist: Es gibt filetierte Tomaten, Rindertatar, Granatapfelkerne und gegrillte Paprikastreifen, dazu mehrere Flaschen Rotwein. Ketchup hätte farblich gepasst, aber wir wagen es nicht, danach zu fragen. Als der Abend sich dem Ende zuneigt, legt Calle sich auf eine Chaiselongue und bittet uns, ihr eine Gutenachtgeschichte vorzulesen, bevor wir gehen. Während wir in ihrer Bibliothek nach einem passenden Buch suchen, fällt unser Blick auf ein kleines Objektiv, das unauffällig hinter den Bänden platziert ist. Wir verlieren darüber kein Wort – schließlich sind wir keine Spielverderber. Warum sollten wir auch dagegen sein, dass dieser Abend unvergesslich wird?

Carsten Höller
Das Erste, was uns beim Betreten seiner Stockholmer Wohnung auffällt, ist ein lautes Vogelgezwitscher, das aus einem der Zimmer zu kommen scheint. Carsten Höller sieht unseren fragenden Blick und erwähnt, dass dort zwei Dutzend Singvögel leben, die er als Haustiere hält. Vorbei an seiner blitzblanken Edelstahlküche (hat er hier jemals gekocht?) sausen wir eine gewundene Tunnelrutsche hinunter und landen leicht verwirrt zwei Stockwerke weiter unten in einem großzügigen, skandinavisch minimalistischen Wohnzimmer. Etwas überrascht blicken wir auf den Esstisch, auf dem sich mehrere Take-away-Boxen türmen. Er hätte heute einfach keine Zeit gehabt, zu kochen, entschuldigt sich der Künstler, aber zum Glück gäbe es ja sein Restaurant „Brutalisten”, das ihm netterweise ein komplettes Festtagsmenü geliefert hätte. In jeder Box versteckt sich eine einzige Zutat, mit Sorgfalt zubereitet: eine graue Garnele hier, eine mexikanische Ameise dort – sogar eines seiner Haustiere hat Höller für uns auf die Reise in die Restaurantküche geschickt, um sie confiert zurückzubekommen. Einen Hausvogel gäbe es nur zu besonderen Anlässen, versichert er. Die Krönung des Abends ist allerdings der Nachtisch, den Höller selbst zubereitet hat: karamellisierter Fliegenpilz, serviert auf einem Moosbett. An das, was danach passiert ist, können wir uns leider beim besten Willen nicht mehr erinnern.