Die Frankfurter Friedensforscher Nicole Deitelhoff und Christopher Daase im Gespräch über Krieg, Frieden und die vielen Schattierungen dazwischen.
Auf dem Boden von Nicole Deitelhoffs Büro im Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung liegen eine Babydecke und Spielzeug. Sie sind für die jüngste Tochter von Nicole Deitelhoff und Christopher Daase bestimmt, die vor fünf Monaten geboren wurde. Daase und Deitelhoff haben gemeinsam drei Kinder, leiten die renommierte Stiftung (Deitelhoff ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied, ihr Mann ihr Stellvertreter) und arbeiten beide als Politik-Professoren an der Frankfurter Goethe-Universität im Rahmen des Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“. Wir haben uns mit den Friedensforschern über Trump und den Brexit, Nationalismus und Europa, Krieg und Frieden und die friedensstiftende Kraft von Kunst unterhalten.
Pegida und AfD, Trump, der Brexit, die Gefahr eines auseinanderfallenden Europas, der Syrien-Krieg. Leben wir in besonders unsicheren Zeiten oder kommt uns das nur so vor?
Daase: Man muss sich fragen: Was heißt Sicherheit? Ich glaube schon, dass es im Vergleich zu früher eine allgemeinere Verunsicherung gibt. Viele Dinge, die uns vorher sicher schienen, sind in Bewegung geraten. Denken wir an die EU, an internationale Institutionen, von denen wir dachten, sie hätten ein bestimmtes Maß an Stabilität erreicht. Wie könnte jemand auf die Idee kommen, ein so erfolgreiches Projekt wie die EU aufzugeben, um in Zeiten des Nationalismus zurückzufallen? Das war für uns undenkbar. Und jetzt trennen uns davon in vielen Ländern nur ein paar Wählerstimmen. Auf der weltpolitischen Seite sieht es ähnlich aus. Auch da existierte früher die Vorstellung, es gäbe eine grundsätzliche Stabilität. Natürlich gab es Konflikte und viele Kriege, aber es gab ein klares Verständnis davon, was internationale Politik, was Krieg und was Frieden ist. Das ist heute anders. Allein die Unterscheidung von Krieg und Frieden ist heute nicht mehr so klar. Konflikte gibt es überall: ethnische Konflikte, Terrorismus. Alles Phänomene, die unsere traditionellen Kategorien in gewisser Weise sprengen. Und gleichzeitig muss man sagen: Es gibt auch viele gute Entwicklungen. Weniger Kriege, weniger Tote.

Ist dieses diffuse Gefühl der Unsicherheit dann auch der Grund für den neuen Rechtspopulismus und Nationalismus?
Deitelhoff: Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Je weniger berechenbar die Gefahr und je unklarer ist, wer uns schützt und wer die Verantwortung trägt, desto stärker der Wunsch nach jemandem, der einfache Antworten bietet. Das merken wir auch in den Ressentiments gegen die Europäische Union. Sie wird als komplex, kompliziert und technokratisch wahrgenommen. Dahinter verbirgt sich natürlich dieses Gefühl: Es gibt keine Nummer mehr, die man anrufen kann, wenn es mal brennt. Das bewirkt die Abwendung von den großen Projekten des 20. Jahrhunderts und den Rückzug. Bei vielen rechtspopulistischen Bewegungen spielt generell eine Ablehnung internationaler Institutionen eine Rolle. Die wollen zurück in einen nationalen Kuschelstaat, den es nie wirklich gegeben hat. Das ist eine romantische Vorstellung von einem Gemeinwesen, in dem man noch direkt aufs Amt gehen und mit dem Zuständigen sprechen kann, der dann effektiv dafür sorgt, dass der Ärger abgestellt wird.

Marine Le Pen präsentiert ihr Wahlprogramm, Image by NdFrayssinet (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Wie verändern unberechenbare Staatsmänner wie Trump, Putin und Erdogan die Welt, und wie gefährlich sind sie?
Daase: Die haben schon ein hohes Chaospotential. Die Hoffnung ist immer, dass das System diese Menschen wieder einfängt. An ein paar Stellen hat man das bei Trump schon gesehen. Er war zum Beispiel gezwungen auf bestimmte Berater zu verzichten. Trump weiß bestimmte Sachen einfach nicht. Abends liest er keine Akten, sondern schaut Fernsehen. Das ist schon problematisch. Aber in dem Maße, in dem Spezialisten und Experten mit Sachkenntnis in die Regierung kommen, wird auch seine Politik vernünftiger. Das ist zumindest die Hoffnung. Gleichzeitig ist Trump natürlich am Ende oft derjenige, der entscheidet. Er besitzt eine Spontanität, die extrem gefährlich sein kann. Wer weiß was passiert, wenn Nordkorea ihn weiter provoziert? Haut er dann irgendwann auf den Tisch und drückt auf den Knopf?

Pjöngjang, Parade zum 75. Jahrestag der Arbeiterpartei, Image by Uwe Brodrecht [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Was genau erforschen Friedensforscher?
Daase: Wir nennen uns zwar Friedensforscher, aber worüber forschen wir hauptsächlich? Natürlich über den Krieg. Wir versuchen aus den typischen Verläufen von Konflikten die Mechanismen herauszufinden, die eine Überwindung dieser Konflikte möglich machen. Friedliche Konfliktlösungen sind das Ziel.
Deitelhoff: Wobei wir auch sehr konkret zum Frieden forschen. Wir haben in der Stiftung einen ganzen Programmbereich, der sich nur mit den Friedensleistungen von Institutionen beschäftigt.
Welchen Institutionen zum Beispiel?
Deitelhoff: Die Vereinten Nationen, eine ganze Reihe der Spezial- und Unterorganisationen. Dazu gehört auch die Europäische Union, aber auch die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation ...
Daase: Und auch die NATO. Durchaus mit einer gespaltenen Bilanz. Die führen auch Krieg. Damit muss man sich auch kritisch auseinander setzen. Inwiefern führt militärische Intervention ein Stück weit zum Frieden? Kann der Einsatz des Militärs auch etwas Gutes bewirken? Ist es richtig und sinnvoll das Militär einzusetzen, um Menschenrechte zu schützen?

Präsident Donald J. Trump, Image By DOD photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jette Carr) [Public domain], via Wikimedia Commons
Was ist Frieden überhaupt, und wie kann man ihn schaffen?
Daase: Es gibt viele Möglichkeiten Frieden zu definieren. Es gibt ganze Bibliotheken zu dem Thema. Es ist schwer, sich den Endpunkt des Friedens vorzustellen. Paradiesische Bilder und Utopien kommen einem da in den Sinn. Wahrscheinlich ist es für unsere Arbeit wichtiger, den Weg in Richtung Frieden einzuschlagen. Das heißt dann: Frieden ist etwas, das immer stärker auf gewaltsame Mittel verzichten kann und den fernen Idealzustand anstrebt.
Also eine schrittweise Abrüstung?
Deitelhoff: Genau. Aber es geht nicht nur darum, die Konfliktparteien von ihren physischen Waffen zu befreien. Sie müssen auch auf Kommunikationsebene entwaffnet werden. Der Diskurs, der entweder komplett zusammengebrochen oder polarisiert ist, muss verändert werden. Ein ganz wichtiger Punkt, das wissen wir aus Friedensverhandlungen, ist dabei die Anerkennung. Ein Grund, warum es häufig in Konflikten so wenige Fortschritte gibt, ist, dass die Konfliktparteien sich nicht wechselseitig als legitime Gesprächspartner anerkennen. Im persönlichen Gespräch ist es einfacher Wertschätzung zu übermitteln und sie glaubhaft zu machen. Aber wenn wir von Konflikten zwischen Gesellschaften oder innerhalb von Gesellschaften sprechen, dann ist schon sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Häufig sind auf beiden Seiten noch externe Akteure involviert und dann wird es viel schwieriger wieder Vertrauen herzustellen.
NATO-Übungseinsatz amerikanischer Panzer in einer deutschen Stadt, Image author Unknown [Public domain], via Wikimedia Commons
Wie schafft man das?
Deitelhoff: Es gibt verschiedene Mechanismen, zu denen wir auch forschen. Zum Beispiel gibt es die klassische Form der Mediation, also der Versuch, unparteiische Dritte ins Spiel zu bringen, UN-Sondergesandte etwa. Oder man versucht, die Parteien aus ihrem direkten Konflikt herauszuziehen: Man lässt Friedensverhandlungen nicht im Konfliktgebiet, sondern ganz woanders stattfinden. Man versucht eine ganz bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Es gab zum Beispiel Verhandlungen, bei denen Chefunterhändler kleine Kinder mitgebracht haben. In den Verhandlungspausen waren die Konfliktparteien mit den Kindern in einem Raum, haben mit ihnen gespielt und kamen so auf eine andere Ebene des Miteinanders. Wenn man aus der Konfliktsituation heraus geht, lernt man leichter sich wertzuschätzen. Das kann man dann später in die Verhandlungen zurücktransportieren.
Sie haben drei kleine Kinder. Werden die den Weltfrieden noch erleben?
Deitelhoff: Ich wage es, ein deutliches Nein zu sagen. Der Weltfrieden ist letztlich eine regulative Idee, die unser Denken und Handeln anleiten sollte.

UN-Soldaten überwachen die Grenze zwischen Eritrea und Äthiopien, Image by Dawit Rezene [CC BY-SA 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0)], via Wikimedia Commons
In der SCHIRN-Ausstellung Peace wird die These formuliert, dass der Frieden von Interaktion und Kommunikation aller im Ökosystem existierenden Akteure bestimmt wird. Was halten Sie von dieser These?
Daase: Erst mal finde ich es wichtig anzuerkennen, das Frieden nicht etwas ist, für das nur die Politik, sondern jeder Einzelne von uns verantwortlich ist. Wir tragen Verantwortung dafür, wie unsere Gesellschaft mit Problemen umgeht, mit der Umwelt, mit Migrantinnen und Migranten, mit allem, dass uns etwas angeht. Da fängt Frieden an.
Deitelhoff: Ich habe den Eindruck, dass ein mehrdimensionales Bild von Frieden in dieser These durchdringt. Hier wird auch Umwelt im Sinne von Biodiversität und Klima als Teil des Friedens berücksichtigt. Wir können nicht nur über die Errichtung von politischen Institutionen und Gesprächen dauerhaften Frieden schaffen. Wir müssen auch bedenken, was unser Handeln für Konsequenzen für unsere Umwelt hat, im ganz basalen Sinne: für die Pflanzen und für die Tiere. Wenn es uns nicht gelingt, die Erderwärmung zu begrenzen, verlieren wir schlicht und einfach unsere Existenzgrundlage. Schon jetzt sehen wir es beim Wasser, das immer mehr zu einer primären Konfliktursache wird, weil einige Gesellschaften keinen ausreichenden Zugang mehr dazu haben. Deshalb: Ja, die These stimmt.

Kann Kunst zum Frieden beitragen?
Deitelhoff: Kunst kann irritieren. Sie kann dazu beitragen, Gewissheiten zu hinterfragen und sie in einem neuen Licht darstellen. Das führt dazu, dass wir anfangen neu zu diskutieren, neu zu fragen. Und das kann ein Beitrag zum Frieden sein.
Daase: Kunst ist auch schon genutzt worden, um zum Krieg zu mobilisieren und Konflikte anzuheizen. Kunst kann aber auch dazu beitragen für den Frieden zu werben. Kunst bildet einen Raum, um sich über bestimmte Fragen Gedanken zu machen: Wie wollen wir leben? Was ist wertvoll?
Deitelhoff: Nicht ohne Grund greifen totalitäre Systeme sehr stark in die Kunstproduktion ein: Sie wollen die Macht über die Definition der Bilder und beschränken damit natürlich auch Diskurse. Kunst kann Diskurse transzendieren.

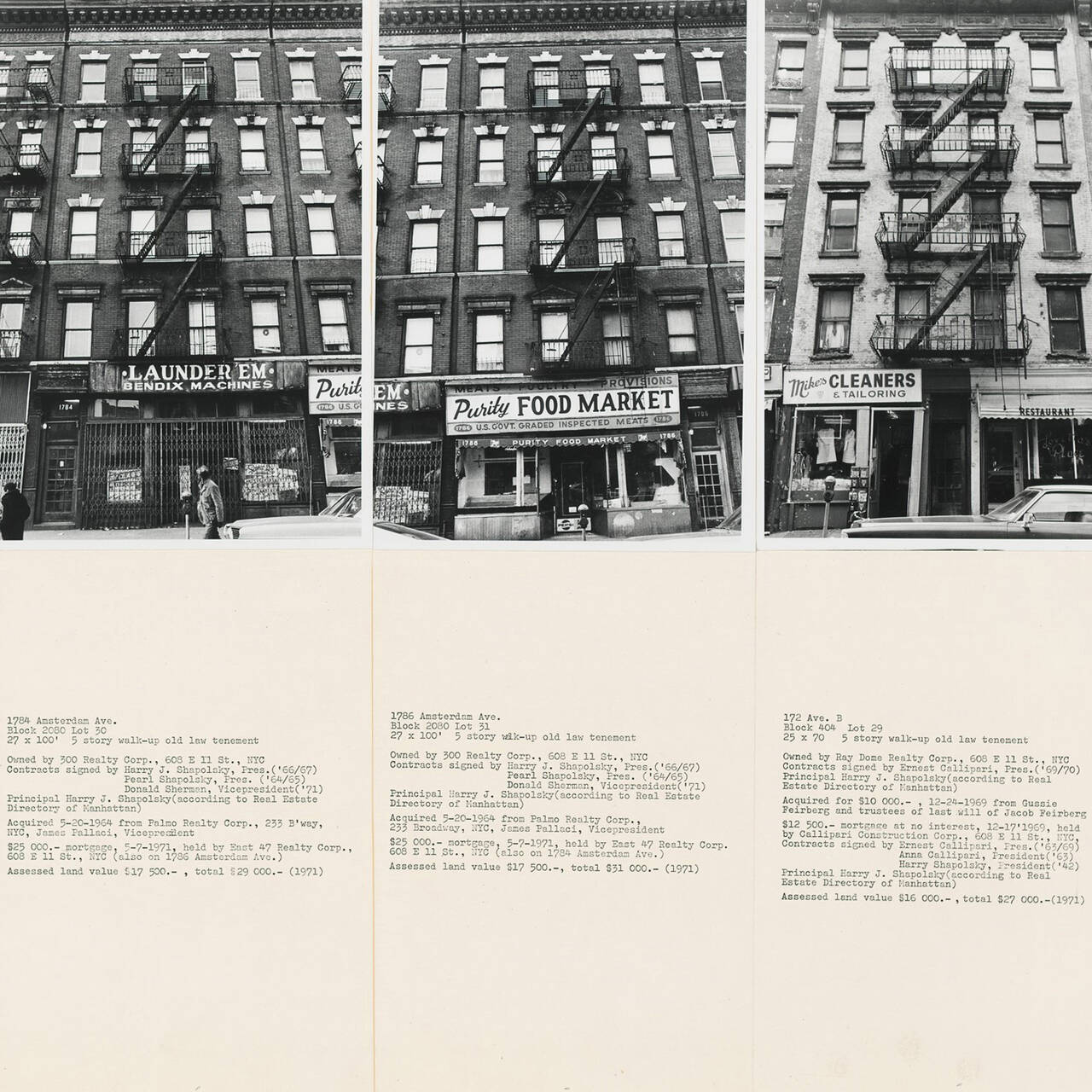
Hans Haacke in New York
Hans Haacke lebt und arbeitet seit 1965 in New York City. Grund genug, seine Beziehung zum „Big Apple” einmal genauer zu beleuchten: Angefangen bei...

Feedback Feminism. Body Reclaimed
Welche gesellschaftlichen Normen bestimmen unser Verständnis von Schönheit? Und wie können wir diese hinterfragen und neu verhandeln? Antworten finden...

ABOUT TIME. Mit Marie-Theres Deutsch
Marie-Theres Deutsch wurde 1955 in Trier geboren. Eine Familie mit fünf Frauen und einem Vater, der Architekt war. Mit sechs Jahren wusste sie: „Ich...

These boots are made for walking
Schuhe erzählen eine Geschichte, geben Geheimnisse preis über die Persönlichkeit derjenigen, die sie tragen, über ihren gesellschaftlichen Status und...

Durch einen Kubus Natur neu sehen
Bereits in seinem Frühwerk setzte sich HANS HAACKE mit dem Verhältnis von Kunst und Natur sowie dem gesellschaftlichen Interesse an Wechselbeziehungen...

Der Film zur Ausstellung: Hans Haacke. Retrospektive
Legende der Institutionskritik, Demokrat, Artist’s Artist: Der Ausstellungsfilm zur großen Retrospektive in der SCHIRN gibt einen Überblick über Hans...

Ein neuer Blick auf Künstlerinnen - „L'altra metà dell'avanguardia 1910-1940“
Mit „L'altra metà dell'avanguardia 1910-1940“ kuratierte Lea Vergine 1980 im Palazzo Reale in Mailand eine der ersten Ausstellungen, die auf...

5 Fragen an Michelle Steinbeck
Am 28. November liest Michelle Steinbeck in der SCHIRN aus ihrem Buch „Favorita“ (2024). Grund genug, der Romanautorin fünf Fragen zu stellen.

Non-Human Living Sculptures im Werk von Hans Haacke und Pierre Huyghe
Bereits in seinem Frühwerk integrierte HANS HAACKE Tiere und Pflanzen als Ko-Akteure in seine Kunst. Damit legte er nicht nur den Grundstein für die...

KURATORINNEN-TALK. CAROL RAMA
SCHIRN-Kuratorin Martina Weinhart spricht mit Christina Mundici, Leiterin des Carol-Rama-Archivs in Turin, Herausgeberin des ersten Catalogue Raisonné...