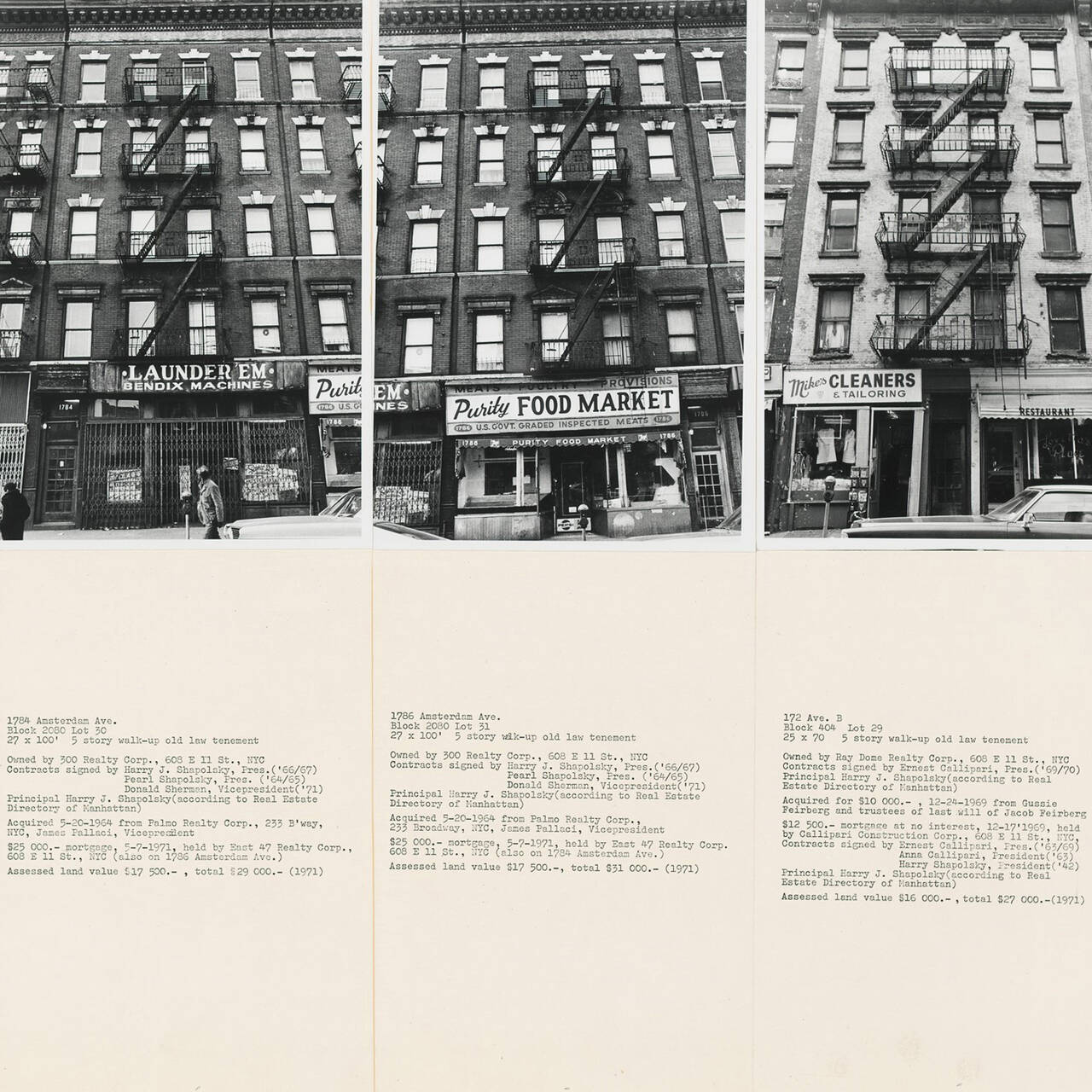Was wäre, wenn Frauen Dichotomien auflösen und heilen könnten? Im kommenden DOUBLE FEATURE holt Elisa Giardina Papa den sizilianischen Mythos der „donne di fora" in die Gegenwart und gedenkt damit jener Frauen, denen im 17. Jahrhundert ebenso heilende wie kriminelle Kräfte nachgesagt wurden.
Ein geflochtener Zopf bahnt sich seinen Weg durch das kleine Loch einer Wand, deren barockes Tapetenmuster im Folgenden zu einer Art Leinwand für das lange, brünette Haar wird. Die an das sorgfältig komponierte Bild anknüpfende Montage wirft den Betrachtenden gleich darauf in eine vollkommene andere Welt: der utopisch anmutende Kirchenbau Chiesa Madre in der sizilianischen Siedlung Gibellina Nuova füllt, ebenso sorgfältig inszeniert, die Bildfläche vollständig aus. Derlei Gegensätze ziehen sich wie ein roter Faden durch Elisa Giardina Papas Videoarbeit „U Scantu: A Disorderly Tale“ (2022), die hier gleichsam die Bild- wie auch auf die narrative Ebene bestimmen.

Die italienische Künstlerin beschäftigt sich in ihrem Werk mit dem sizilianischen Mythos der „donne di fora“,was sich in Deutsch wohl am ehesten als „Frauen von außen und neben sich“ übersetzten ließe. Ihnen wurden alle möglichen Heilungskräfte nachgesagt, konnten sie der Erzählung nach doch beispielsweise den titelgebenden „Scantu“, die sprichwörtliche Angst vorm Leben, vertreiben. Im 17. Jahrhundert wurden jene Frauen so von Teilen der Bevölkerung geehrt, von anderen gefürchtet und von der Inquisition als Ketzerinnen marginalisiert und verfolgt. Den Erzählungen nach vereinen die „donne di fora“ Dichotomien wie das Weibliche und Männliche, Menschliche und Tierische sowie das Wohlwollende und Rachsüchtige in sich, und versöhnen jene Kategorien gleichsam.
Das Überwinden von Dichotomien
Elisa Giardina Papa folgt im weiteren Verlauf von „U Scantu“ mit der Kamera eine Gruppe Bikerinnen, die sich im Rahmen der Arbeit als Reimagination jener „donne di fora“ verstehen lassen. Zu dröhnenden Bässen lassen sich die jungen Frauen durch die verlassenen, modernen Architekturlandschaften der sizilianischen Siedlung Gibellina Nuova treiben – einer Planstadt aus den späten 1960er-Jahren, die nach der vollständigen Zerstörung der historischen Stadt Gibellina Vecchia durch ein Erdbeben im Sinne moderner Stadtplanung erbaut wurde. Lyrisch-assoziativ schildert eine Stimme aus dem Off Versatzstücke aus Erzählungen über die „donne di fora“, nennt deren Namen und Taten, berichtet von Verfolgung und Strafe.


Elisa Giardina Papa strukturiert ihr Werk in drei Abschnitte, die jeweils mit eigener Zwischenüberschrift versehen werden. Endet der Film im historischen Palazzo Biscari, wo eine Ziege durch das imposante Gebäude streift, verknüpft der mittlere Abschnitt beide Filmteile sprichwörtlich mit Seilen. Arme und Beine werden ebenso wie Pflanzenblätter oder eine Zitrone kunstvoll geschnürt. Mit ganz ähnlichen Seilen haben Frauen damals wohl auch Personen geschnürt, die von dem „Scantu“ befreit werden sollten. Nach einigen rituellen Worten und Handlungen wurden die Fesseln aufgeschnitten und der Fluch, die Angst, die Schwermut waren gebannt. So schwingt in Papas Arbeit auch die Verknüpfung von Gegenwart und Vergangenheit mit, vielleicht in der Hoffnung, menschliche Dichotomien und Kategorisierungen einzufangen und gleichermaßen aufzulösen.

Einblicke in die Kultur der Mapuche
Als weitere Filme hat sich Elisa Giardina Papa zwei Arbeiten von Seba Calfuqueo ausgesucht. Calfuqueos Familie entstammt den Mapuche, einer indigenen Bevölkerungsgruppe Südamerikas, deren angestammtes Gebiet sich von Chile ins benachbarte Argentinien erstreckt. „You will never be a Weye“ (2015) thematisiert im Rahmen der spanischen Kolonisation systematisch verfolgte Schamaninnen, die in der Kultur der Mapuche eine wichtige Rolle einnehmen und nicht der binären Geschlechterstruktur entsprachen. Der Film reflektiert den Einfluss der kolonialen Geschichte auf die eigene wie auch familiäre Identität sowie die fortwährende Diskriminierungsgeschichte. Im Mittelpunkt der Arbeit „TRAY TRAY KO“ (2022) steht der Trayenko (Wasserfall), der in der Weltanschauung sowie in Ritualen der Machupe eine besondere Stelle einnimmt und als heiliger Ort beschrieben wird. In Rahmen einer Performance bewegt sich Calfuqueo in einem blau glänzenden Gewand entlang des Flusses und betritt schließlich den Wasserfall, der sie buchstäblich vollkommen in sich aufzunehmen scheint.

SEBA CALFUQUEO, TRAY TRAY KO, 2022, Image via sebacalfuqueo.com