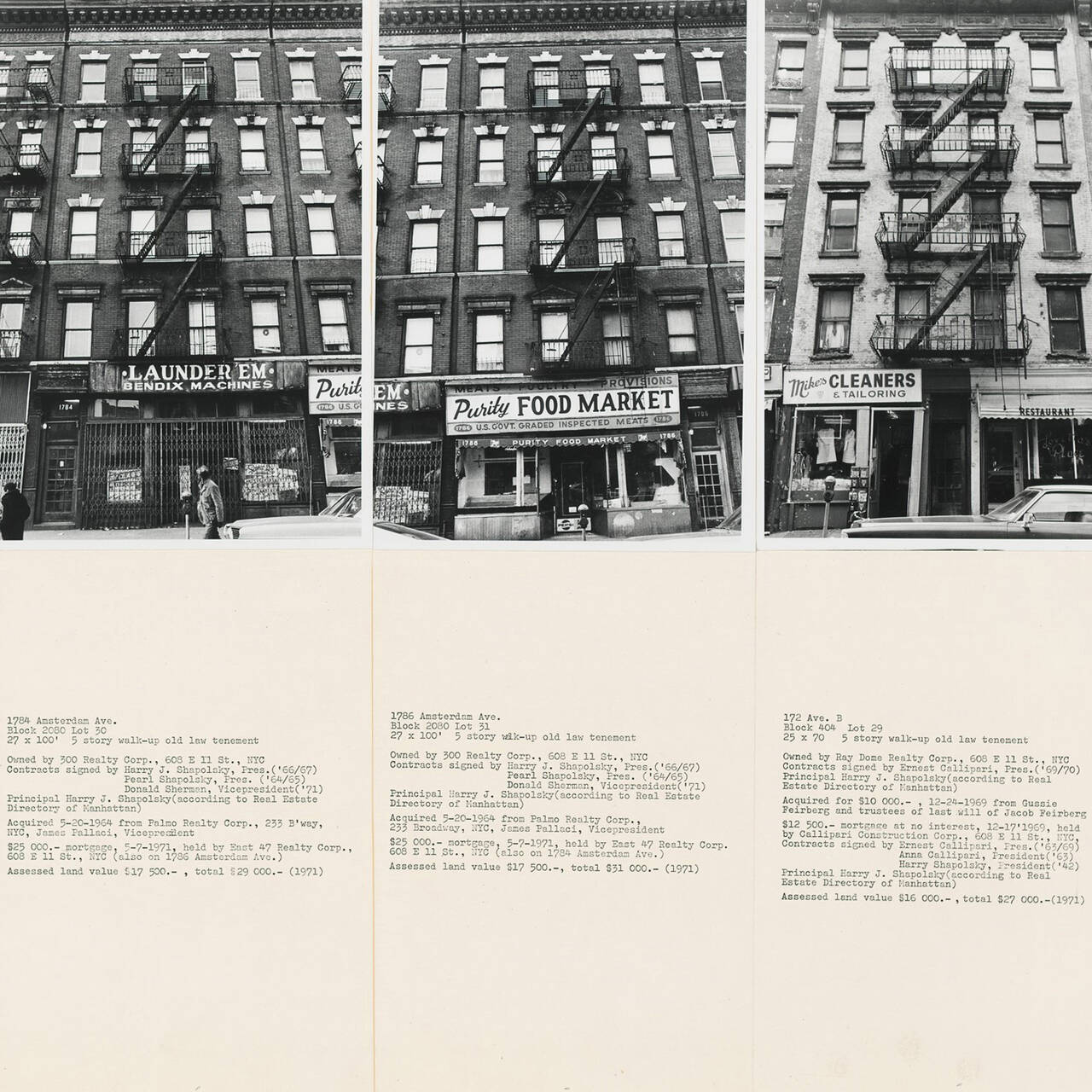Künstlerin Bani Abidi widmet sich den dunklen Absurditäten des Alltags. In ihrer Videoarbeit „The Distance from Here“ nimmt die Bürokratie überhand und Warten wird zur existentiellen Lebensaufgabe.
Zwei alte, angerostete Tische, ein schon in die Jahre gekommener Klappstuhl, eine auf dem Boden liegende Schreibmaschine und ein Schild mit der Aufschrift „LEGAL DOCUMENTATION CENTRE (REGD.)“ eröffnen das Bild in Bani Abidis „The Distance from Here“ aus dem Jahr 2010. Die sorgfältig inszenierten, statischen Gegenstände, auf die die Kamera den Blick freigibt, könnten symbolisch kaum besser verkörpern, was die Protagonist*innen in dem gut zwölf-minütigen Werk über sich ergehen lassen müssen: ausgeliefert sein, der eigenen Zeit beraubt vom Subjekt zum Objekt werdend.
In ihrem fiktionalisierten Dokumentarfilm inszeniert Abidi einen Tag im Leben von Visa-Anwärter*innen, die in ein anderes Land reisen möchten, aber im Zwischenraum verschiedener Staaten festsitzen. Zwei Sicherheitsbeamte trinken stoisch einen Kaffee, bevor nach und nach immer mehr Menschen auf dem großen, asphaltierten Platz – einem vorgezogenen Checkpoint – eintreffen. Sie werden durch Sicherheitschecks gelotst, ihre Dokumente werden überprüft und an kleinen Pop-up-Lädchen werden Ansteckkrawatten und Kaffee verkauft. Dann: zwischen gelb-markierten Linien auf Busse warten, die einen schließlich zum Konsulat bringen. Dort jedoch geht das Warten für die Antragssteller*innen nur weiter: in einer großen Halle sitzend, geduldig den Moment herbeisehnend, an dem die eigene Nummer endlich aufgerufen wird.
Was macht die Bürokratie mit dem Individuum?
Die pakistanische Künstlerin Bani Abidi pendelt seit Jahren immer wieder zwischen Pakistan, Indien, USA und Deutschland, wo sie seit einigen Jahren in Berlin lebt. In ihrem Werk bestehend aus Videoarbeiten, Fotografien und multimedialen Installationen, hat sie sich immer wieder in Form von fiktionalisierten Dokumentationen mit Themen wie staatlicher Allmacht, Nationalismus sowie den Auswirkungen von Bürokratie auf das Individuum auseinandergesetzt und sich hierbei oft einer lakonisch-humoristischen Inszenierung bedient.

In „The News“ aus 2001 wird das identische Ereignis so von zwei Nachrichtensprecherinnen aus deren jeweils nationalistischen Perspektiven Pakistans und Indiens geschildert, in der Zwei-Kanal-Videoinstallation „Death at 30 Degree Angle“ (2012) kann sich ein lokaler Politiker in einem Künstleratelier nicht recht entscheiden, wie das Antlitz seiner Steinstatue nun genau aussehen soll. Und in „An Unforseen Situation“ (2015) persifliert die Künstlerin identitätsstiftende, nationale Geschichtsschreibung, anknüpfend an ein von pakistanischen Behörden mit großem Brimborium veranstalteten Sportereignis.
Von stoischer Gelassenheit, gelangweilter Leere bis hin zu unsicherem Bangen
Auch „The Distance from Here“ inszeniert Bani Abidi den behördlichen Ablauf mit humoristischen Untertönen, als theaterhafte Groteske: die Antragsstellung selbst wird nie gezeigt, stattdessen befinden sich die Visa-Anwärter*innen in einer Art Limbus, in dem es kein Entkommen gibt. Lediglich in den Gesichtern der Menschen meint man ihre emotionalen Zustände, von stoischer Gelassenheit, gelangweilter Leere bis hin zu unsicherem Bangen, zu erkennen. Gesprochen wird fast kein Wort. Stattdessen ist die Tonspur durch permanentes Schreibmaschinentippen, Gepiepe von Körperscannern und weit entferntes Verkehrsrauschen durchzogen.

Fest an sich gepresst und immer gut sichtbar, halten die Ausharrenden ihre Ausweisdokumente, ihr kostbarstes Gut, bei sich: das Einzige, was sie hier zu tatsächlichen Menschen zu machen scheint, das ihnen in der bürokratischen Vorhölle irgendeine Legitimation verschafft. Das Reisen – in anderen Regionen der Welt von Vorfreude und Komfort geprägt – zeitigt hier vielmehr die komplette Unfreiheit und Abhängigkeit des Einzelnen von der staatlichen, abstrakten Autorität, die sich in die Gesichter der Individuen eingraviert.

Als zweiten Film hat sich Bani Abidi „Divine Intervention“ (2002) des palästinensischen Regisseurs Elia Suleiman ausgesucht. In lakonisch-surrealistischer Weise erzählt der Film ebenso von Grenzen und staatlicher Übermacht, hier in der Grenzregion zwischen Israel und dem Westjordanland. In episodenhaften, überaus repetitiven Sequenzen beschwört Suleiman zu Beginn ein trostloses Bild vom Alltag in der West Bank, das ein wenig an die Inszenierungen in Aki Kaurismäkis Filme erinnert.
Nur agieren die Menschen hier deutlich boshafter miteinander als in den Werken des finnischen Filmemachers. Die Erzählung schwingt irgendwann um auf einen namenlosen Mann (gespielt vom Suleiman selbst), der in Jerusalem wohnt und tagein, tagaus auf einem Parkplatz an einem israelischen Checkpoint seine Geliebte aus Ramallah trifft. Die Willkür von Grenzbeamten, die Allmachtsfantasien von gebeulten Bürgern, die Alltäglichkeit von Missgunst und Gewalt – all das verwebt Suleiman in „Divine Intervention“, der auf den Festspielen in Cannes 2002 den Jurypreis erhielt, zu einem bitteren Abgesang. Dem allein, wenn überhaupt, vielleicht noch die stille Zuneigung zweier Personen zueinander etwas entgegenzusetzen hat.