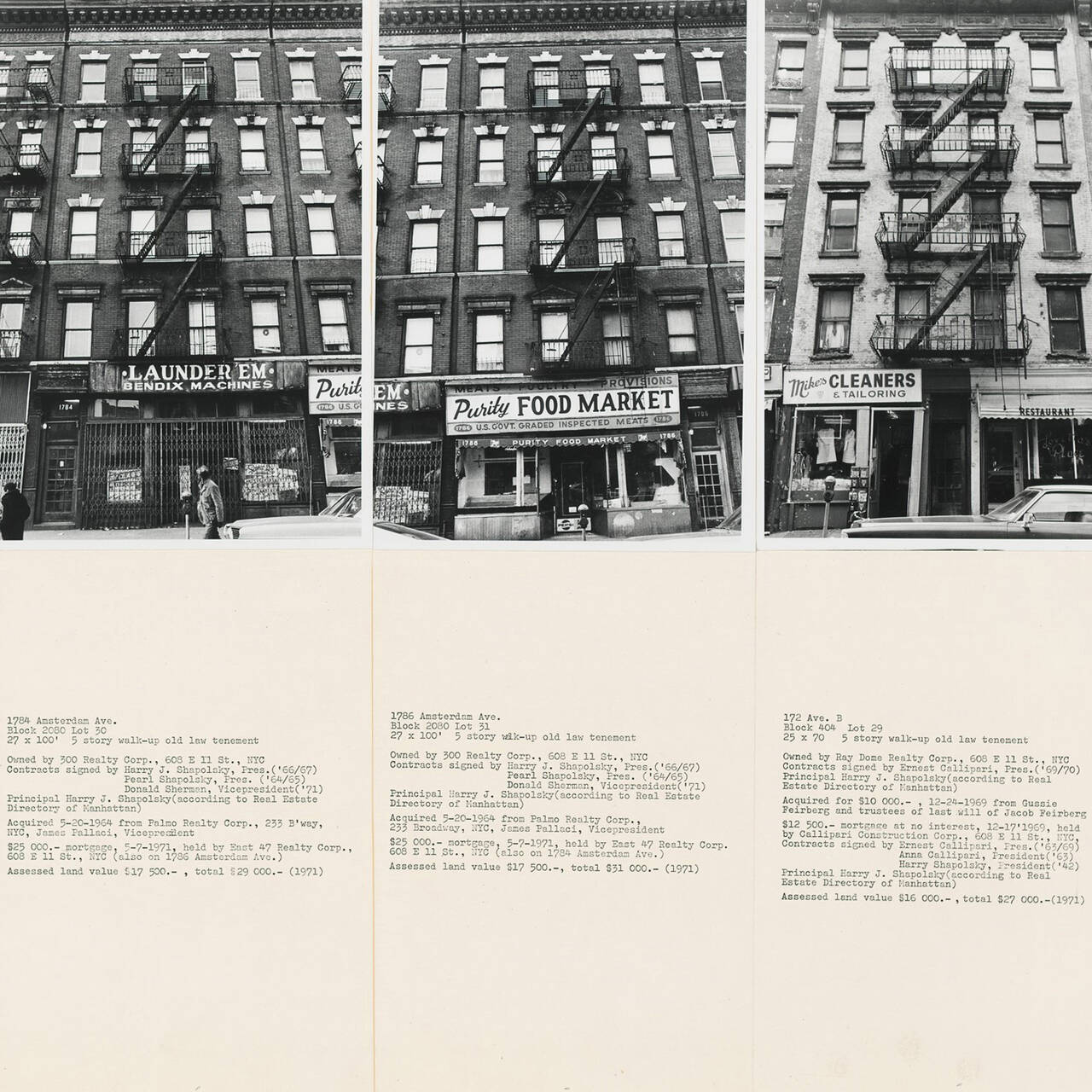Viele Künstlerinnen hatten tierische Traumwesen als Alter Egos. Mit ihren surrealistischen Persona eroberten sie sich so ein Stück Freiheit.
„Lass uns vorstellen, wir wären zu Pferden geworden“, sagt Lucretia, die Protagonistin in „Die ovale Dame“, einer Kurzgeschichte der surrealistischen Künstlerin und Schriftstellerin Leonora Carrington. „Ich selbst werde mich in ein Schneepferd verwandeln.“ Als Lucretia’s Vater daraufhin droht, ihr geliebtes Pferd – ein Hybrid zwischen Spielzeug und Lebewesen – zu verbrennen, bettelt sie um Erbarmen: „Hab Mitleid, Papa!“. Doch er verbrennt es.
Das Pferd in der Geschichte ist ein Sinnbild für Lucretias Vorstellungskraft. Eine Kraft, die, wie öfter in Carringtons Geschichten, von männlichen Antagonisten kontrolliert oder zerstört zu werden droht. Wie viele Künstlerinnen ihrer Zeit hatte Carrington selbst lange damit zu kämpfen, auf ihre Partner, insbesondere den Surrealisten Max Ernst, reduziert zu werden. Dennoch: ihrer eigenen Vorstellungskraft waren, anders als der ihrer Charaktere, kaum Grenzen gesetzt. In Carringtons Geschichten und Malereien tummeln sich pfauenartig schillernde Traumwesen, weise Stiere, maskierte Hyänen und unheimliche Löwenfrauen genauso wie tänzelnde Hunde und Katzen.
Besonders auffällig sind die Pferde – insbesondere das weiße Pferd –, die etwa als übergroße Gottheit auftreten, wie in „Die magische Welt der Maya“ (1963), oder als dialektisches Alter Ego, wie in „Selbstportrait“ (1937-38). In letzterem inszeniert Carrington sich auf einem viktorianischen Sessel. Daneben schwebt ein weißes Schaukelpferd wie merkwürdig erstarrt im Raum. Durch ein glasloses Fenster ist ein Schimmel zu sehen, der energisch in eine vernebelte Waldlandschaft flieht. Zumindest ein Teil der Künstlerin, so wirkt es in dem Bild, ist auf dem Weg, sich ein Stück Freiheit zurück zu erobern.
Lass uns vorstellen, wir wären zu Pferden geworden.

Tiergestalten finden sich aber keineswegs nur bei Carrington, sondern tatsächlich bei einem Großteil der Surrealistinnen. Woher stammt diese Faszination? Die surrealistischen Tiere stehen für Rätselhaftigkeit und Metamorphose, sie eröffnen den Blick aufs Verdrängte, Unheimliche, vermeintlich Periphere – auf Dinge außerhalb der sprichwörtlichen Domestizierung des Denkens. Sie passen eben nicht in die Weltsicht der Aufklärung, eine Weltsicht, die die menschliche Vernunft ins Zentrum alles Denkens und Handelns stellt.
Wer Dora Maar kennt, kennt ihre Obsession mit hybriden Wesen und Objekten
In Dora Maars Werken eröffnen sich solcherlei „andere“ Perspektiven durch das Medium der Fotografie. Wer sich mit der Künstlerin auseinandersetzt, kennt ihre Obsession mit hybriden Wesen und Objekten. Die vielleicht bekanntesten Beispiele sind ihr unbetiteltes Bild einer Muschelhand (1934) sowie das schaurige „Portrait of Ubu“ (1936). Letzteres zeigt ein Wesen, das mit seinen hängenden Ohren an einen Elefanten erinnert, in seiner glänzend-schuppigen Oberfläche aber eher wie ein Reptil aus einer unbestimmten Vergangenheit – oder Zukunft? – wirkt. Tatsächlich handelt es sich um den Fötus eines Gürteltiers. Dass sich in Fotografien surreale Abgründe auftun können, wird auch in weniger außerweltlichen Bildern von Maar deutlich, etwa in dem Portrait „Frau mit Seife in den Haaren“ (1934). Indem die Künstlerin die vertikale Bildperspektive schlichtweg in die Horizontale verlegt, scheinen Hände, Haare und Schaum in dem Bild zu einer oktopusartigen Krone mit Eigenleben zu verwachsen.

Dora Maar, Portrait of Ubu, 1936 © VG Bild-Kunst, Bonn 2019, Image via cs.nga.gov.au
In einer Fotomontage wie „Rue d’Astorg“ (1936) dagegen verzerrt Maar, was real erscheint, ins Unwirkliche: Eine rundliche Frauenfigur sitzt auf einem Hocker in einem seltsam verkrümmten Gang der Orangerie in Versailles. Ihr Kopf wirkt vogel- oder raupenartig und viereckig. Die angedeutete Nacktheit des Körpers sowie die Schönheit der Umgebung, in der er sich befindet, kippt ins Unheimliche und Groteske. Trotz des Facettenreichtums und der Medienvielfalt ihres Schaffens wurde Maar, wie Carrington, zu Lebzeiten und auch posthum auf ihre männlichen Partner reduziert (Maar galt als Muse Pablo Picassos).
Tiere spielen in den Bildern der von Frida Kahlo eine bedeutende Rolle
Das wohl bekannteste Gegenbeispiel – eine Surrealistin, deren Schaffen nicht von der Aufmerksamkeit auf ihren Künstlerpartner überschattet wurde – ist die mexikanische Malerin Frida Kahlo. In ihren unverwechselbaren Selbstportraits verhandelte sie Weiblichkeit und Ethnizität genauso wie die Politik ihrer Zeit und ihr persönliches Schicksal. Tiere spielen in den Bildern der inzwischen zur Pop-Ikone verklärten Künstlerin keine unbedeutende Rolle.

So liest sich ihr „Selbstbildnis mit Dornenhalsband“ (1940), das während der Trennung von Diego Rivera entstanden sein soll, fast wie eine Satire der Symbolhaftigkeit darin versammelter Wesen: ein Kolibri, in Mexiko ein Hoffnungssymbol, hängt wie Jesus aufgefaltet und tot von einer Dornenkette, die Kahlo blutige Wunden in den Hals schneidet. Der Wink an die christliche Leidensgeschichte liegt auf der Hand. Ein Affe schnürt ihr das Dornengestrüpp noch enger zusammen, vertieft die Wunden (ganz anders als die zierlich-netten Tiere in Kahlos späterem „Selbstbildnis mit Affen“ (1943)). Eine schwarze Katze, in der westlichen Folklore bekanntlich eine Unglücksbotin, lauert hinter ihr, wie zum Sprung ansetzend. Und über Kahlo steigen blumenartige Schmetterlingswesen aus einem violetten Haarzopf hervor –gegenüber den anderen Tieren wirken sie wie verpuppte Vorboten einer Verwandlung, eines Neuanfangs.
Jane Graverol war selbst eine überzeugte Surrealistin
Viele der genannten Künstlerinnen weigerten sich zeitlebens, als Surrealistinnen bezeichnet zu werden. Ganz anders die belgische Malerin Jane Graverol, selbst eine überzeugte Vertreterin: „Surrealist zu sein, ist eine Befindlichkeit, die man in sich trägt oder nicht“, sagte sie 1940 in einem Gespräch mit der Kunsthistorikerin José Vovelle. In Graverol‘s Collagen werden Tierwesen auf ihre Konturen reduziert und mit formfremden Bildern angereichert.

„Das Wohlergehen des Lasters“ (1967) zeigt einen Raubvogel, der statt Federn schweres Kriegsinstrument wie Panzer und Gewehrläufe in sich trägt. Auf ihm sitzt wie schwerelos, was wie ein Frauenkörper aussieht, doch anstatt eines Torsos oder Gesichts sind nur dornige Blätter und Blüten zu sehen. Die im Bild der Frau und des Raubvogels liegenden Zuschreibungen und Klischees werden grotesk überzeichnet, sodass die Körperlinien zu Stellvertretern einer techno-romantischen Dystopie werden. Es ist die Überzeichnung der Formsprache eines Körpers, bzw. seine Reduzierung auf seine Kontur, die Graverol’s subtile Kritik ausmacht.
Im englischen Vorwort zu Leonore Carringtons „Die ovale Dame“ verweist die Kunstkritikerin Gloria Orenstein auf den mythologischen Stellenwert der Kurzgeschichte. So lasse das Ovale etwa auf das Ei schließen: als ein Symbol für Fruchtbarkeit und Transformation. Die Dame bedeute eine Gottheit, die „neue Frau“, die Rohmaterial auf magische Art und Weise in Leben verwandelt. Orenstein sieht darin André Breton’s Losung nach „wahrhafter Okkultation“ aus dem Zweiten Surrealistischen Manifest widerhallen. Das Mythologische und sich Verwandelnde in Carrington’s Kurzgeschichten, das ist sicher, ist ein Motiv, das die Werke vieler Surrealistinnen durchzieht. Obwohl der Surrealismus als eine der zugänglichsten Bewegungen der modernen Kunst gilt, hält er noch viele Geheimnisse bereit – nicht selten treten diese in Form tierischer Mischwesen auf.
Surrealist zu sein, ist eine Befindlichkeit, die man in sich trägt oder nicht.