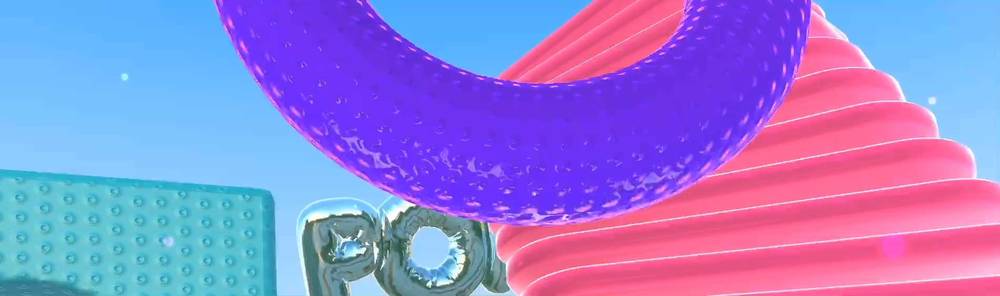Die Sammlung des Design Museum Brussels umfasst ausschließlich Objekte aus Plastik. Kein Wunder, dass einige der zwischen Kunst und Design angesiedelten Werke in PLASTIC WORLD von dort ausgeliehen wurden. Sammlungsleitung Cristina Bargna spricht mit uns über die Geschichte, Herausforderungen, und Zukunft der Kunststoffobjekte.
Liebe Frau Bargna, erzählen Sie uns doch erst einmal etwas über sich selbst und die von Ihnen betreute Sammlung. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem Thema Plastik im Design und was zeichnet das Design Museum Brussels in besonderer Weise aus?
Cristina Bargna: Ich bin Industriedesignerin und im Norden Italiens aufgewachsen. Dort war ich umgeben von Designunternehmen und historischen Manufakturen, die vorwiegend mit den Materialien Holz und Kunststoff arbeiteten. Während meines Studiums am Politecnico di Milano lernte ich dann die Methoden und Wertsetzungen des Industriedesigns kennen als ein transdisziplinärer Beruf, der sich der Verbesserung unserer Lebensqualität anhand von Problemlösungsprozessen verschrieben hat. Ganz unerwartet entdeckte ich meine Faszination für die Auswirkungen von Kunststoffen auf die italienische Gesellschaft der Nachkriegszeit, als das Land mit seinen stark verwurzelten handwerklichen Traditionen wiederaufgebaut werden musste und das „miracolo economico“, das italienische Wirtschaftswunder, erlebte.
2015 weckte die Eröffnung des Design Museum Brussels meine Aufmerksamkeit, und im darauffolgenden Jahr kam ich nach Brüssel. Die „Plastic Design Collection“ wurde seit den 1980er-Jahren von dem Brüsseler Sammler Philippe Decelle (*1949) zusammengetragen und nach Eröffnung des Museums durch Schenkungen und Ankäufe noch erweitert: Sie umfasst rund 2.300 vollständig aus Kunststoff gefertigte Objekte. In Verbindung mit der 800 m2 großen Dauerausstellung gleichen Namens bietet sie eine einzigartige Gelegenheit, das 20. und das 21. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen Design und Kunststoff zu betrachten – von den Golden Sixties und dem damals einsetzenden Wirtschaftsaufschwung bis hin zur Gegenwart und unserem heutigen Blick auf Massenfertigung, Konsumdenken und Nachhaltigkeit.

Die Ausstellung PLASTIC WORLD in der SCHIRN widmet sich der Materialgeschichte von Plastik in der Kunst, wohingegen der Fokus Ihrer Sammlung auf Design liegt. Wie griffen seinerzeit Designer*innen den neuartigen Werkstoff auf?
Cristina Bargna: Ich würde sagen, sie waren begeistert von Kunststoffen und ihren schier grenzenlosen gestalterischen Möglichkeiten. Denn Plastik hat ja keine fest vorgegebene Form. Es ist – wenn man so will – neutral: Seine Gestalt erhält es erst durch die Vision des oder der Designenden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dienten Polymere noch als Ersatzwerkstoff für kostbare Materialien wie Elfenbein oder kamen in der Militär- oder Transportindustrie zum Einsatz. Doch schon bald offenbarte sich ihr eigentliches Potenzial. Gegenstände aus Kunststoff veränderten die Welt und unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, denn praktisch alle konnten sie sich leisten.
1939 entdeckten die Besucher*innen der New Yorker Weltausstellung Bakelit, Nylon oder Plexiglas für sich und gingen mit der Vorstellung nach Hause, eine fortschrittliche und freiheitliche Zukunft gesehen zu haben, in der die neuen synthetischen Polymere eine entscheidende Rolle spielen würden. An die Stelle der anfänglich negativen Reaktionen auf Kunststoffobjekte, die nicht länger Spuren der handwerklichen Fertigung aufwiesen, trat schon bald die Sehnsucht nach dieser alchemistischen Welt, die in der Gießform Gestalt anzunehmen versprach. Designer*innen und Industrie machten sich daran, eine neue Beziehung zwischen Verbraucher*innen und Gegenständen des täglichen Gebrauchs, die nunmehr zu Produkten wurden, zu etablieren. Neue Orte des Konsums wie Supermärkte oder große Einkaufszentren sowie Versandhauskataloge und das Aufkommen des Radios förderten den Massenkonsum. Dabei kam der Werbung zentrale Bedeutung zu. Kund*innen konnten sich die beworbenen Gegenstände im eigenen Zuhause vorstellen und somit die Utopie einer hellen, strahlenden Zukunft lebendig werden lassen. Farbenfrohe und leicht zu produzierende Waren weckten neue Kaufwünsche, was wiederum Einfluss auf unsere Lebensweise nahm.

Wie würden Sie den generellen Umgang mit Kunststoffen im Design seit Beginn des "Plastic Age" beschreiben: Dominierte damals eine Kunststoffeuphorie, wie sie etwa in der Pop Art zu beobachten war, oder gab es auch Designer*innen, die – ähnlich wie die Nouveaux Réalistes in der Kunst – schon in den 1960er-Jahren eine kritische Haltung gegenüber dem Material Plastik einnahmen?
Cristina Bargna: In den 1950er- und 1960er-Jahren führte die Verbreitung einfach zu formender und zu produzierender thermoplastischer Polymere wie ABS und Polyethylen zu einer explosionsartigen Ausweitung der Massenfertigung. Der Wunsch nach Erneuerung, der die Golden Sixties auszeichnete – als knallige Pop-Farben auf Technikgläubigkeit und die gerundeten Formen des Weltraumzeitalters trafen –, wurde Ende der 1960er-Jahre abgelöst von Experimenten mit PVC und Polyurethan als innovativen weichen Kunststoffen. Die damals entstandenen Objekte markierten einen Wendepunkt und verwarfen das Paradigma, dass die Form der Funktion zu folgen habe. Bei dem von Studio 65 gestalteten Sessel „Capitello“ (1971) kippt die massive griechische Säule um und zerbricht in mehrere Teile. Etablierte Werte wie Dauerhaftigkeit und Monumentalität wandelten sich zu einer weichen Oberfläche, die die Form des auf ihr sitzenden menschlichen Körpers annahm. Von der Last der Tradition befreit, provozierten und infiltrierten Kunststoffe die Kanäle industrieller Produktion und Distribution, indem sie sich verhüllten und zum Erproben neuer Formen der Interaktion einluden.

Studio 65: Capitello, 1971, Image via markanto.de
Polymere – sie bildeten einen der wesentlichen Gründe für die explosionsartige Zunahme von Massenproduktion und Konsum – wurden in den Händen von Designer*innen und Künstler*innen zu einem Werkzeug, um das kapitalistische System, seine Unterwerfung unter die Gesetze des Marktes und die eigene Rolle in ihm zu hinterfragen. So prangerte etwa der Künstler und Aktivist Piero Gilardi, ein Vertreter des radikalen Designs der späten 1960er-Jahre, unsere künstliche Lebensweise sowie Industrialisierung und Konsumdenken an und schuf seine „tappeti“: hyperrealistische Reproduktionen natürlicher Umgebungen, die mithilfe von Industriematerialien wie expandiertem Polyurethan und synthetischen Pigmenten nachgebildet wurden. Verwendeten die Designer*innen der 1960er- bis 1970er-Jahre noch Kunststoffe, um sich ihr Potenzial zunutze zu machen oder aber auf ihre Vergänglichkeit zu reagieren, so erkunden sie heute neue Möglichkeiten des Recyclings von Abfall. Die Spielregeln haben sich gewandelt: Zum einen geht es darum, innovative Ausgangsmaterialien, Fertigungsweisen oder Verwendungsmöglichkeiten für Objekte zu finden, zum anderen sehen sich Designer*innen mit der neuen Identität dieses Werkstoffes konfrontiert, der nun bereits eine Form, eine Farbe und einige spezifische Eigenschaften aufweist.

Welche Designschulen des 20. Jahrhunderts sind besonders erwähnenswert und was zeichnete sie aus?
Cristina Bargna: Die einflussreichste und fortschrittlichste Schule des 20. Jahrhunderts war meiner Meinung nach die Hochschule für Gestaltung Ulm. Sie wurde 1947 als Erbin des Bauhauses gegründet, löste sich aber mit dem Eintritt von Tomás Maldonado (1922–2018) und Hans Gugelot (1920–1965) schon bald von der eher handwerklich geprägten Vision ihres Gründers Max Bill (1908–1994). Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, ein internationales Zentrum für Produktgestaltung und -entwicklung zu werden, und wollte Designer*innen zugleich einen Sinn für soziale Verantwortung vermitteln. Bereits Ende der 1940er-Jahre führte sie den Grundsatz ökologischer Nachhaltigkeit ein und formulierte eine ethisch-soziale Verantwortung des Designs. In die traditionelle Gestaltungslehre integrierte sie wissenschaftliche Disziplinen wie Kybernetik, Informationstheorie, Semiotik, Ergonomie oder Bionik, um zu einem besseren Verständnis der Beziehung zwischen dem Menschen und seiner natürlichen, technischen sowie ökonomischen Umgebung zu gelangen.
Als grundlegend erwies sich dabei die Zusammenarbeit zwischen Studierenden und namhaften Unternehmen wie IBM, Olivetti, Fiat oder Herman Miller für die Entwicklung ebenso demokratischer wie verantwortungsvoller Lösungen für Objekte, Grafikdesign oder Verpackungen. So führte etwa die fruchtbare Partnerschaft zwischen Dieter Rams (*1932) und dem deutschen Unternehmen Braun zur Gestaltung eines der berühmtesten Braun-Produkte: des „Sixtant“-Rasierers (1961). Ein ikonisches Objekt herauszugreifen, das für sich genommen die Komplexität und den Stellenwert von Design in Kunststoff repräsentiert, fällt schwer, gerade wenn wir von einer Familie von Polymeren mit jeweils eigenen ästhetischen Vorgaben und mechanischen Eigenschaften sprechen. Und doch vereint dieser kleine Gegenstand des täglichen Gebrauchs in sich die meisten Aspekte, die den Erfolg des Materials im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg ausgemacht haben: Er ist das Ergebnis eines nutzer*innenzentrierten Problemlösungsprozesses, befeuert durch Innovationen im Hinblick auf Technologie und Materialeinsatz, Ergonomie, Erschwinglichkeit und Farbgebung.

Sixtant“-Rasierer, 1961, Image via the-frankfurter.com
Abgesehen von den verheerenden Folgen für die Umwelt – aus welchen Gründen sollte die Verwendung von Kunststoffen aus heutiger Sicht überdacht und reduziert werden? Welche Tücken birgt Plastik im Design?
Cristina Bargna: Die Ölpreiskrise von 1973 hat uns die eigene Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen vor Augen gestellt. Schon damals wurde deutlich, dass sich Plastik in unserer Umgebung, ja sogar in unserem Körper anhäuft und beides vergiftet. Tomás Maldonado hat etwa in seinem 1971 verfassten Buch „Umwelt und Revolte“ darauf hingewiesen, dass wir Plastik nicht einfach so wieder loswerden, denn bei der Zersetzung kehren sie in ihren ursprünglichen molekularen und chemischen Zustand zurück und setzen dabei Schadstoffe frei, die sich in unserem Lebensraum ansammeln, ihn kontaminieren und korrodieren. Die Auswirkungen betreffen nicht allein die Umwelt, auch unsere Gesundheit. Die Tatsache, dass Studien das Vorhandensein von Kunststoffen wie PVC oder Polypropylen, die vor allem für Einweg-Plastikprodukte (SUP) wie Strohhalme, Flaschen, Besteck oder Verpackungsmaterialien zum Einsatz kommen, im menschlichen Körper belegt haben, wirft die Frage danach auf, ob Kunststoffe das eigentliche Problem sind oder vielmehr die Weise, wie wir sie gestalten, konsumieren und entsorgen.
Ändern wir jedoch Parameter und Kontext der Betrachtung, so zeigt sich, dass ins Museum gelangte Objekte aus Kunststoff nicht ewig halten. Ganz im Gegenteil – ihre Zersetzung schreitet in einigen Fällen sogar schneller voran als die natürlicher Materialien. Dies wiederum führt dazu, dass wir uns mit neuen und rapiden Alterungsprozessen auseinandersetzen müssen und darüber hinaus auch mit einem Bewusstsein dafür, dass eine solche Sammlung in Gefahr ist. Heute stellen wir fest, dass einige unserer Objekte inzwischen zu empfindlich sind, als dass man sie noch ausstellen oder auch nur aus ihrer Transportkiste herausnehmen könnte. Das gilt etwa für die beiden „tappeti“ Piero Gilardis, die in PLASTIC WORLD zu sehen sind.
Hat seit dem Aufkommen von Plastik ein Umdenkprozess bei Designer*innen stattgefunden, was die Wahl des Materials betrifft? Wie äußert er sich und welchen Platz nimmt Kunststoff im aktuellen Designdiskurs ein?
Cristina Bargna: Sowohl Theoretiker*innen wie Victor J. Papanek (1923–1998) oder Ezio Manzini (*1945) als auch Designer*innen haben seit den 1970er-Jahren die Auswirkungen dieser „Wegwerfmentalität“ angeprangert und auf die Verantwortung verwiesen, die allen Beteiligten an dem Prozess, auch den Verbraucher*innen, zukommt. So widmete sich der italienische Designer Enzo Mari (1932–2020) anschließend an sein Projekt „Autoprogettazione“ dem Do-it-yourself-Design zum Selberbauen. Sein Projekt „Ecolo“ von 1995 beinhaltet eine Anleitung zur Umgestaltung von Spülmittelflaschen zu Vasen. Auch er selbst zerschnitt Plastikflaschen und gestaltete daraus eine Reihe von Vasen. Interessenten hatten also die Wahl zwischen seiner Anleitung oder einer von ihm signierten Vase. Doch Mari machte nicht nur auf die Bedeutung von Recycling aufmerksam, er betonte auch die Wichtigkeit von Open Source für die demokratische Aufgabe von Design. Während die einen das System infrage stellten, erkundeten andere Gestalter*innen den Werkstoff selbst, indem sie nach Alternativen in Form biobasierter Kunststoffe oder nach verbesserten Recyclingtechnologien für Polymere suchten. Erst kürzlich feierte der ikonische Stuhl „RCP2“ (1992) der britischen Designerin Jane Atfield (*1964) sein 30-jähriges Jubiläum. Er entstand aus Altkunststoffen etwa von Shampooflaschen und war ein Pionierprojekt für die Entwicklung recycelter Kunststoffe in Großbritannien.
Es bestehen mehrere mögliche Szenarien nebeneinander: So wenden sich einige Designer*innen gegen das kapitalistische Wirtschaftssystem und steigen aus ihm aus, andere hingegen bleiben in der Industrie und treiben von dort aus die Forschung nach neuen alternativen Materialien und Prozessen voran, um Produktionsrhythmen zu verlangsamen und die Material- und Energieverschwendung über den gesamten Lebenszyklus der Objekte hinweg zu reduzieren.
/https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-roma/2019/07/16/111056744-2637fcc9-4185-4da6-82d3-f2deac3c4fb6.jpg)
Enzo Mari: Ecolo, Alessi, Image via basilearteco.it

Jane Atfield: RCP2, 1992, Image via thedesignedit.com
Was bedeuten diese Veränderungen konkret für Ihre Sammlung und das Museum? Wie reagieren Sie darauf?
Cristina Bargna: Die anfangs beschworene Utopie und das Vertrauen in Polymere sind unweigerlich in eine globale Krise geraten, die sämtliche Aspekte unseres Lebens betrifft. Den Kern unseres Sammlungsbestands hat Philippe Decelle anhand spezifischer Kriterien zusammengetragen. Besonders wichtig war ihm dabei, dass die Entscheidung für das Material Kunststoff aufgrund seiner technischen oder ästhetischen Eigenschaften erfolgt war und weniger aufgrund der mit ihm verbundenen Kostenersparnis. Die Sammlungsstücke der „Plastic Design Collection“ spiegeln insofern ihre Epoche, als sie für eine Symbiose mit oder Reaktion auf den industriellen Kontext und die Konsumgesellschaft stehen. Heute vollziehen wir neue Wege nach, die Designer*innen im Hinblick auf innovative Materialien, neue Gestaltungs- oder Fertigungsweisen beschreiten. Wir erweitern kontinuierlich den Sammlungsbestand um historische ebenso wie aktuelle Stücke, die Lücken schließen und ein Bild des derzeitigen Umfelds zeichnen, in dem die Grenzen zwischen Kunst, Design und Handwerk sowie zwischen dem Physischen und dem Digitalen verschwimmen.
Parallel hierzu verbessert das Museum schrittweise die konservatorischen Bedingungen für die nach Kunststoffarten geordneten Depotstücke. Unser Ziel ist es, die Öffentlichkeit über die komplexe Erhaltung dieses Erbes des 20. Jahrhunderts zu informieren und das Interesse einer neuen Generation von Restaurator*innen für diesen Tätigkeitsbereich zu wecken. So arbeiten wir etwa mit der École nationale supérieure des arts visuels – ENSAV La Cambre in Brüssel zusammen, die einen eigenen Ausbildungsgang für die Konservierung und Restaurierung aus synthetischen Materialien gefertigter Objekte eingerichtet hat. Eine weitere Achse, der wir seit Kurzem nachgehen, ist die Integration digitaler Tools in unsere tägliche Praxis. Noch befindet sich das Projekt in der Anfangsphase, aber wir planen, unser Inventar online zu stellen, um den Bestand zumindest in Form eines visuellen Gedächtnisses zu bewahren und einen breiteren Zugang zum Kulturerbe Kunststoff zu ermöglichen.
Können Sie eine Prognose wagen, welche Richtung das Design in den nächsten Jahren einschlägt?
Cristina Bargna: Eine vollständige Ersetzung von Kunststoff ist nur schwer vorstellbar – zumindest kurzfristig. Der Problemkreis umfasst weitaus mehr als nur das Material. Dieses hat ja nicht singulär unsere Wegwerfgesellschaft hervorgebracht, vielmehr spielten für den Prozess, der letztendlich zu einer Wegwerfkultur führte, ökonomisch-soziale Impulse oder Verhaltensweisen eine wichtige Rolle. Man denke nur an die serielle Fertigung von Einwegbesteck in den 1950er-Jahren, als die Mittelschicht Flug- und Bahnreisen zu unternehmen begann und unterwegs mit Mahlzeiten versorgt werden musste. Marketingstrategien zeichneten damals das Bild einer erstrebenswerten Zukunft, in die kurzlebige Produkte von temporärer Funktionalität traten.
Hier gilt es, ein komplexeres Bild in den Blick zu nehmen, in dem unterschiedliche Faktoren wie die übermäßige Ausbeutung von Rohstoffen oder die Auslagerung von Fertigungsprozessen miteinander verwoben sind. Die Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine, aber auch des Übergangs zur Digitalisierung und des Aufstiegs der KI, um nur einige Aspekte zu nennen, haben uns dazu veranlasst, unsere Beziehung zu und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zunehmend zu überdenken sowie die Frage danach zu stellen, was das Leben in der Stadt und einer Gemeinschaft ausmacht. Wir alle sind dazu aufgefordert, neu über die Fertigung, Gestaltung und Verwendung von Kunststoffen nachzudenken, denn der Wandel kann nicht nur von der Industrie, er muss auch von den Verbraucher*innen ausgehen. Der überbordende Einweg-Plastikmüll und der unmäßige Verbrauch von Papier oder Strom für die zahlreichen elektronischen Geräte, die im Begriff stehen, an die Stelle menschlicher Gesten und Rituale zu treten, sind eine unumstößliche Tatsache und stehen stellvertretend für eine nunmehr untragbar gewordene Lebensweise. Wir müssen neue Praktiken und Systeme erkunden und gleichzeitig die bestehenden verbessern. Insofern bietet sich ein Verweis auf den Begriff „Projekt“ an, der den Akt des Vorherplanens und Vorausdenkens nächster Schritte hin in eine neue, wünschenswerte Zukunft ankündigt.