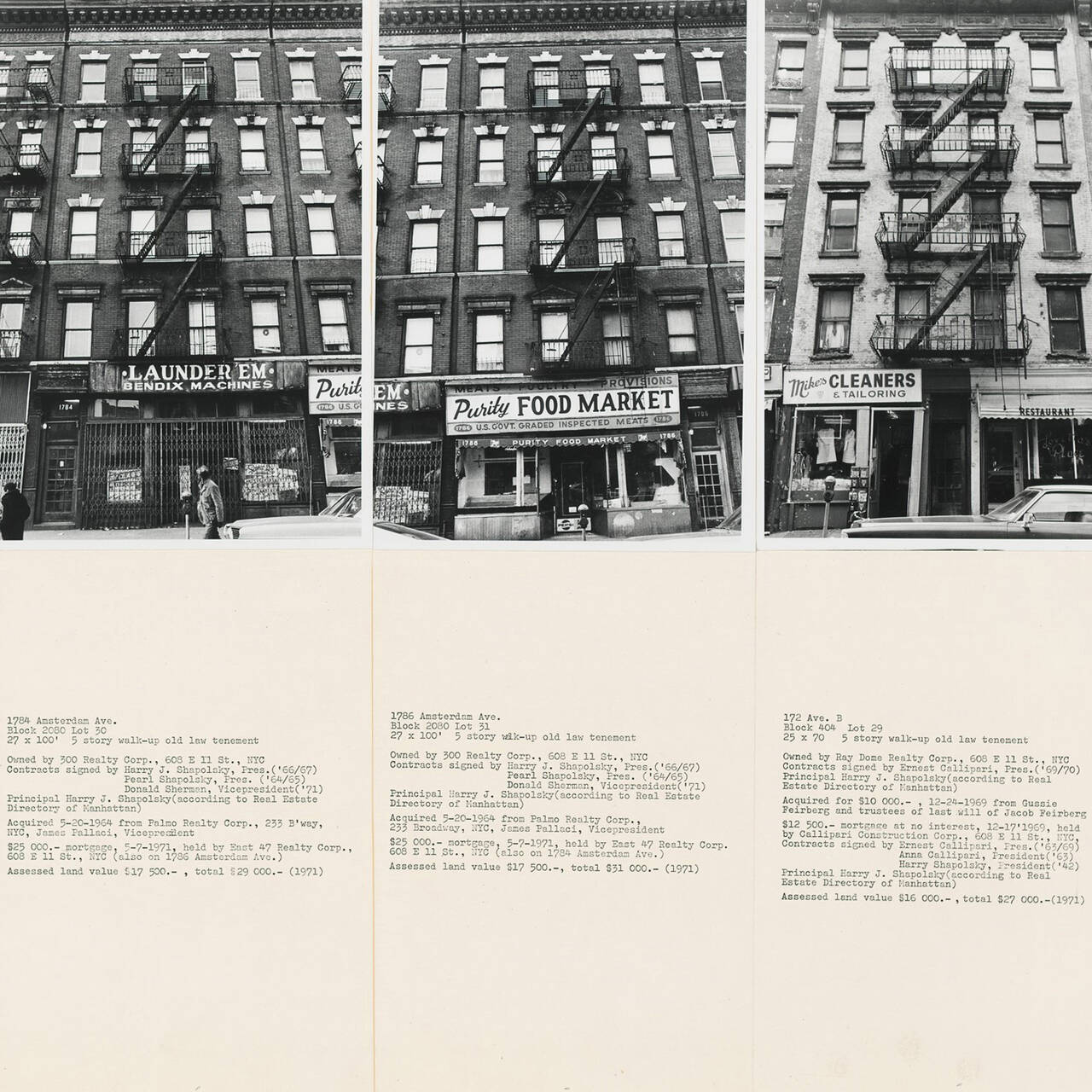Der Künstler Alfred Ullrich hat genügend Jahrzehnte in und mit dem Kunstbetrieb verbracht, um zu wissen, dass sich die Zuschreibungen immer wieder ändern können. Die eigene Familiengeschichte brodelte womöglich schon länger unter der Oberfläche seiner abstrahierten Farbradierungen – offen thematisiert hat er seine Biografie aber erst später. Wie es dazu kam, erzählt er im Interview.
Künstler? Sinto-Künstler? Wiener oder Deutscher Künstler? Das mit den Identitäten sei so eine Sache, sagte Alfred Ullrich mir einmal. Er hat genügend Jahrzehnte in und mit dem Kunstbetrieb verbracht, in Druckwerkstätten, Galerien, Künstler*innengruppen und Ausstellungsräumen, um zu wissen, dass sich die Zuschreibungen immer wieder ändern können. Und das, was gerade gewünscht ist, ebenso. „Es ist schwierig für mich, mich als Künstler zu sehen,“ sagt der Mittsiebziger noch heute. Aufgewachsen ist Ullrich als Sohn einer Sintizza, die den Nationalsozialismus überlebte, in Wien. Eine schöne Kindheit, im Planwagen und im Heu, umherziehend, doch stets am Rande der österreichischen Gesellschaft stehend. Die eigene Familiengeschichte brodelte womöglich schon länger unter der Oberfläche seiner abstrahierten Farbradierungen – offen thematisiert hat Alfred Ullrich seine Biografie erst später.


Herr Ullrich, Sie waren Lebensmittelverkäufer, Schriftsetzer, Postfacharbeiter, haben im Bronzeguss und an Münchner Bühnen als Bühnenarbeiter gearbeitet…
Alfred Ullrich: Und noch mehr!
…und dann sind Sie mit Ende 20 Künstler geworden, beziehungsweise: haben die Druckgrafik für sich entdeckt. Wie kam das?
Alfred Ullrich: Das war so ungefähr 1976 – nach einigen Jahren ziellosem Umherwandern in Europa, wurde ich auch nicht mehr von den Deutschen Behörden für den Wehrdienst erfasst – wie alt war ich da? Vielleicht 28. Da war ich schon eine Weile in Bayern. Eigentlich bin ich ja Wiener. Als ich als Jugendlicher einen Personalausweis benötigt habe, wurde man damals quasi gleichzeitig schon für den Wehrdienst gemustert. Da haben mir die umgekehrten Familienverhältnisse geholfen: Obwohl meine Mutter nur zwei Jahre mit meinem deutschen Vater verheiratet war, konnte ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Ich wollte auf keinen Fall Wehrdienst leisten, wo Vorgesetzte arbeiten, die noch im Dritten Reich aktiv waren – das konnte ich mir nicht vorstellen. Als 14-jähriger ist mir da nichts anderes eingefallen, als die deutsche Staatsbürgerschaft zu wählen. Was dazu führte, dass ich in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, fortan als „Fremder“ regelmäßig zur Polizei musste. Es war eine eigenartige Situation. So bin ich dann irgendwann als Deutscher nach München gezogen, wo ich unter anderem in einer Druckwerkstatt gearbeitet habe. Unter dem Tschechen Josef Werner, der selbst viel für andere gedruckt hat. Das war eine lehrreiche Zeit, das Arbeiten mit der Farbradierung hat mir sehr gefallen. Trotzdem ist es mir in dem Familienbetrieb dann doch irgendwann zu eng geworden…später habe ich ein Haus in Dachau gefunden und konnte mir dort eine eigene Kupferdruckwerkstatt einrichten. Da fing es langsam an, dass ich nicht nur viel für andere Künstler gearbeitet habe, sondern auch eigene Arbeiten anfing. Damals konnte man noch mit einer Mappe in die Münchner Galerien gehen – manchmal ist auch etwas ausgestellt worden.

Sie sind 1948 in Bayern geboren und dann in Wien aufgewachsen, als Sohn einer alleinerziehenden Sintizza. Viele Ihrer Familienmitglieder sind im Nationalsozialismus ermordet worden, darunter Ihr älterer Bruder. Die eigene Biografie trat aber erst später in Ihre Kunst ein. Hatten Sie Sorge, Ihre Arbeit zu sehr identitätstechnisch zu vereinnahmen?
Alfred Ullrich: Ja, das ist mir eigentlich erst so richtig klar geworden, als ich dieses Haus im Landkreis Dachau bezogen habe. Diese alte Römerstraße, da bin ich ja täglich am ehemaligen KZ vorbeigekommen. Damals dachte ich mir: Ich weiß doch eigentlich alles, durch meine überlebenden Verwandten, ich muss mir das doch nicht anschauen. Erst später erfuhr ich dann, dass drei meiner Onkel in diesem KZ interniert waren.
Zugleich musste ich mich erst einmal zurechtfinden. Für mich war es interessant zu sehen, was die Künstler da so machen, wie dieses kultiviert-bürgerliche Leben so abläuft, und welchen Stellenwert die Kunst da so hat. Das habe ich in diesen Jahren erst herausgefunden. Mein Leben war ja ein vollkommen anderes gewesen.
Trotzdem gab es durchaus politisches Bewusstsein. In Dachau hat sich Mitte der 80er-Jahre die sogenannte „Gruppe D“ gebildet, die sich für eine Gedenk- und Begegnungsstätte am ehemaligen KZ einsetzte. Über die Gruppe D bin ich selbst hin und wieder mitgereist, zum Beispiel wurden wir von einem ehemaligen Resistance-Kämpfer eingeladen, in Frankreich auszustellen. Auch in Vermont oder im Jugendbegegnungszentrum Auschwitz waren wir zu Gast. Zu der Zeit wurde die Vergangenheit noch mehr oder weniger verdrängt – in den 60er-Jahren gab es sogar Pläne, das ganze Gelände abzureißen. Es soll damals einen Politiker gegeben haben, der sagte, er werde „bis zum letzten Blutstropfen“ gegen eine solche Begegnungsstätte vorgehen [der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Stadtrat, Manfred Probst, Anm. d. Red.] Es ist interessant, wie Politiker damals reagiert haben – jetzt heißt es Max-Mannheimer-Haus und ist ein Studienzentrum mit Bildungs- und Begegnungsstätte, Gedenkstätte und Jugendherberge.


Bleiben wir noch einen Moment bei der Druckgrafik: Sie haben sehr unterschiedliche Arbeiten angefertigt – farbenprächtige Abstraktionen, die Sie an die bunte Kleidung Ihrer Mutter erinnert, aber auch Abdrucke von Ottakringer Bierdosen, Flammruß auf Malpappe…wie entwickeln Sie Ihre Arbeit? Ist das ein Nachdenken, Überlegen im Machen, oder gehen Sie konzeptionell vor?
Alfred Ullrich: Ich habe mir eigentlich vieles so, ohne in irgendwelchen „Rezeptbüchern“ zu lesen, durch autodidaktisches Probieren, im Arbeiten selbst angeeignet, und habe dann oft entdeckt, dass diese oder jene Methode eigentlich von Künstlern schon vor Jahrzehnten angewendet worden ist. Irgendwie bieten sich, wenn man sich mit der Radierung beschäftigt, gewisse Dinge einfach an.
Als Autodidakt hatte ich keine klassische Ausbildung als Zeichner, deshalb meist spontan begonnen. Dieser spontane Beginn, diese Ätzung hat mich dann inspiriert, weiter zu machen. Das bedeutet aber auch: Eigentlich habe ich eine Morgenstimmung vorgehabt, durch das Experimentelle ist dann eher eine Abendstimmung draus geworden (lacht). Jetzt habe ich sehr viel Eigentechnik, mit der ich arbeiten kann. Das ist gut, weil ich nach wie vor viel zu unruhig bin, um mich da stunden-, tage-, monatelang hinzusetzen und beispielsweise zu zeichnen.
Später haben Sie dann Videoarbeiten und Aktionen realisiert. Erst da ist das Thema, die verdrängte Vergangenheit, sowohl gesellschaftlich als auch für Sie künstlerisch virulenter geworden.
Alfred Ullrich: Richtig, mit Hilfe von Freunden, die sich mit der Technik besser auskennen als ich. Weil ich gesehen habe, dass ich allein mit abstrahierter Druckgrafik der Sache nicht gerecht werden kann. Durch diese Aktionen oder auch Videos wie „Landfahrerplatz, kein Gewerbe“ – da konnte ich performativ etwas in Frage stellen. Weil ich gesehen habe: Ohne Provokation bewegt sich nichts in der Gesellschaft.
Interessanterweise ist es dann, auch durch Initiativen wie die der Gruppe D, dazu gekommen, dass die aufgeschlosseneren Leute „aus ihrer Deckung“ herausgekommen sind – und diese Ausstellungen besucht, sogar befürwortet haben. Da hat schon ein gewisser Wandel stattgefunden. Und für mich war es auch eine gewisse Erleichterung, mich zu meiner Identität sozusagen zu „bekennen“. Denn ich habe oft festgestellt, auch im Austausch mit künstlerischen Kollegen, dass ich da einfach oft eine ganz andere Sicht auf die Dinge habe. Bei den künstlerischen Aktionen konnte ich dann etwas deutlicher werden – ohne aber jemanden persönlich anzugreifen, das war mir immer wichtig. Ich wollte eher die Politik dazu bringen, irgendeine Stellungnahme zu beziehen.
Wie hat das Kunstpublikum denn damals reagiert? Immerhin haben Sie da Themen und Tatsachen reingebracht, die gesamtgesellschaftlich nicht nur verdrängt, sondern großteils komplett tabuisiert waren.
Alfred Ullrich: Ich war damals schon seit zwei Jahrzehnten als Druckgrafiker bekannt. Zu meinen Einzelausstellungen sind immer recht viele interessierte Leute gekommen. Die sind auch zu diesen Ausstellungen gekommen und haben sich wirklich darauf eingelassen. Ich habe damals zum Beispiel in der Neuen Galerie Dachau mal ein Sofa aufgestellt, Tischchen dazu, einige Schälchen mit Nüssen darin, aber im Fernsehen lief eben ein Video meiner Schwester, das sie mit meiner Mutter gemacht hat, wo sie über ihre Zeit im KZ gesprochen hat. Das war sehr anrührend, weil sie oft anhalten musste, nicht weitersprechen konnte.
Da fällt mir gerade ein Spruch ein, den meine Mutter öfters gesagt hat: „Die Gadji, pass auf, pass auf, die Gadji – so nannte sie die Deutschen -, die stehlen!“ Also interessanterweise reziprok, wie die Mehrheitsgesellschaft die Sinti und Roma sieht. Heute denke ich, zu wissen, was sie meinte. Durch das KZ, durch die Raubzüge hat sich ja bestätigt, wer die eigentlichen Diebe und Räuber sind.
2000 haben Sie die Aktion „Perlen vor die Säue“ im tschechischen Lety durchgeführt. Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers, in dem vor allem Rom*nja inhaftiert waren, befand sich seit den 1970er-Jahren bis 2018 ein Schweinezuchtbetrieb. Ihre Schwester überließ Ihnen die Perlen ihrer Kette, die Sie dann in einer performativen Aktion vor das Eingangstor warfen. Wurde eine Dokumentation der Aktion nicht später auch in Venedig gezeigt?
Alfred Ullrich: Ja, ich glaube, das war 2011. Inzwischen hat der tschechische Staat das Gelände erworben und 2022 den Betrieb endgültig abgerissen. [Jana Horváthová, Direktorin des Museums für Roma-Kultur, das hier ein Denkmal errichten wird, bezeichnete den Abriss als „Wendepunkt“. Der aktuelle Kultusminister Martin Baxa entschuldigte sich, auch für die zahlreichen Politiker*innen, die diese Geschichte des Landes jahrzehntelang ignoriert hatten, Anm. d. Red.] Jetzt bin ich gerade wieder in einer Gruppenausstellung auf der Biennale vertreten. Als ich da mit der Bahn angekommen bin in Venedig, Mitte April, wurde ich kurz darauf von einer Gruppe ausgeraubt. All mein Geld war weg, meine Karten. Als ich bei den Carabinieri erschien, musste ich ein Formular ausfüllen, und auf diesem Formular stand geschrieben: „Können Sie sich daran erinnern: Waren das Araber oder waren das Zigeuner?“ Das wird so heute abgefragt. Da ist mir doch ganz anders geworden mit dieser Ausstellung – weil diese Weltkunstschau heuer ja doch sehr betroffenheitsmäßig sich präsentiert. Eine Betroffenheit, die fast schon schwierig ist zu rezipieren. Wenn andererseits der Staat, der dieser Kulturveranstaltung Raum gibt, nun 2024 solche Formblätter ausgibt. Das könnte man sich in Deutschland vermutlich nicht mehr erlauben.
Da stellt sich für mich natürlich die Frage, welche Bedeutung Kunst überhaupt haben kann. Seit 100 Jahren wird diese Biennale veranstaltet, und dann auch noch unter so einem Motto wie in diesem Jahr – ist das jetzt nur so Publicity? Aber für wen? Es kommen ja eh zu viele Touristen nach Venedig …und dass das ausgerechnet mir passiert, hat schon eine gewisse Ironie.





Aktuell arbeiten Sie an Radierungen über die Seeschlacht von Lepanto, und auch die hat auf eine Weise mit Venedig und mit Antiziganismus zu tun.
Alfred Ullrich: Das bereite ich für die Ausstellung im Januar in Berlin vor. Weil es eine Seeschlacht war, wo sich also alles im Wasser abspielt, wollte ich nicht zu konkret werden. Dabei beziehe ich mich auf die Geschichte an diesem Ort: Der spanische König hatte die Gitanos, die damals dort lebenden Roma, für vogelfrei erklärt – und die wurden dann gegen die Türken, die das Mittelmeer beherrschten, in den Galeeren eingesetzt. Umgekehrt haben auch die türkischen Machthaber damals Roma als sogenannte „Rudersklaven“ genutzt. Das war eigentlich der Anlass für meine Arbeit: die Erkenntnis, dass diese Diskriminierung seit Jahrhunderten in verschiedensten Variationen weiterbesteht. Und das bis zum heutigen Tage. Ich habe die Arbeiten nicht rechtzeitig fertigbekommen, aber die Ausstellung wird später von Venedig nach Berlin weiterziehen. Dort werde ich sie dann zeigen.
Sie sind jetzt seit bald viereinhalb Jahrzehnten im Kunstbetrieb unterwegs. Wie empfinden Sie Ihre Rolle hier heute?
Alfred Ullrich: Einerseits bin ich wohl sozusagen irgendwie integriert, andererseits habe ich da noch immer oft den Blick von außen. Obwohl ich eben systemimmanent bin. Da denke ich, dass ich eigentlich einen Vorteil habe, weil ich das tun kann – aber gleichzeitig auch von außen auf die Dinge blicke. Wobei ich die Kunstgrafiken für sich wirken lassen möchte, ohne da etwas Aktivistisches oder Ideologisches in den Raum zu stellen. Das ist mir wichtig.
Es ist schwierig für mich, mich als Künstler zu sehen. Die Druckgrafik war ja etwas, das ich zwischen mich und die Gesellschaft stellen konnte. Dadurch habe ich vermieden, über das Eigentliche zu sprechen, das mich bewegt. Diese alten Vorhänge, mit denen meine Mutter hausieren gegangen ist, wobei ich sie oft begleitet habe, und die Vorlage vieler Arbeiten sind: Diese Vorhänge hängen oft als Schleier zwischen der Wahrnehmung – zwischen dem, was passiert ist, und dem, wie es durch die Nachfahren der Täter heute gern dargestellt wird. Da sind die Vorhänge, die dazwischen hängen, und die für mich ein wirkliches Gespräch, ein wirkliches Reflektieren behindern.